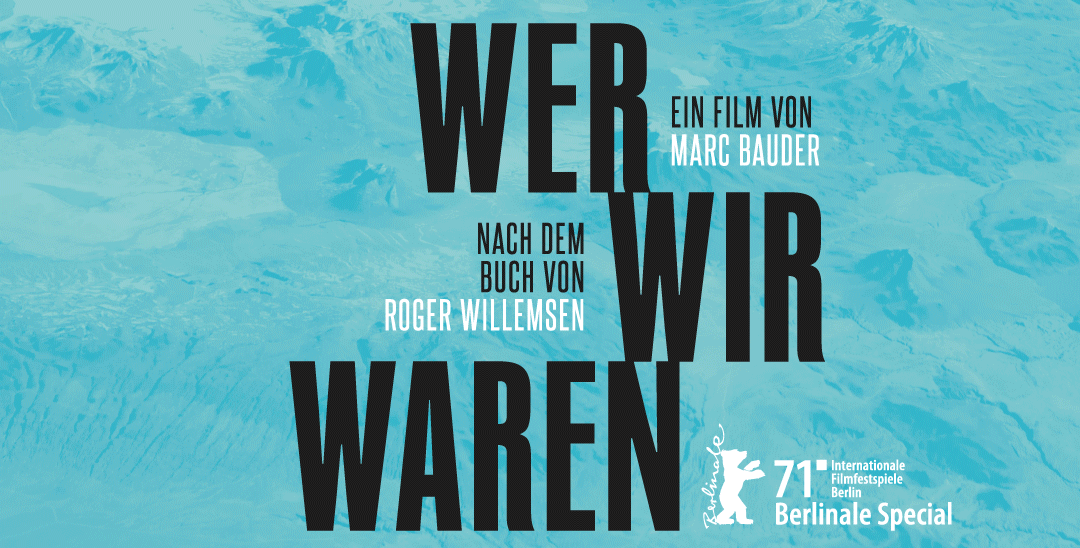
Ungeheure Gefährt*innenschaften – der Beginn einer Reise. Eine philosophische Reflexion zu Marc Bauders Film Wer Wir Waren
von Janina Loh (Wien)
In der altgriechischen Tragödie Antigone des Dramatikers Sophokles gibt es einen Satz, der mich schon lange beschäftigt, wenn auch immer wieder erneut und aus unterschiedlichen Gründen. Er lautet übersetzt etwa »Es gibt viele ungeheure Dinge, aber nichts ist ungeheurer als der Mensch«. Da ist zunächst die Doppeldeutigkeit des Wortes »ungeheuer« oder »ungeheuerlich«. Das Ungeheure im menschlichen Wesen treibt mich als Technikphilosophin in der Tat in seinen zahlreichen Facetten schon aufgrund meiner Profession um. Dinge, die uns ungeheuer erscheinen, sind häufig groß und mächtig, zuweilen auch unerklärlich und deshalb vielleicht sogar gruselig, sie sind uns tatsächlich nicht »geheuer«, können sowohl schlimm und gefährlich als auch wunderbar und nicht- bzw. übermenschlich in einem großartigen Sinne sein. So etwa von Menschen geschaffene Technologien und Techniken, also Artefakte und Praktiken. Sie reichen von wie ungeheure Wunder wirkenden Dingen wie der Sprache und Schrift, dem Buchdruck, Medikamenten, Flugzeugen, Raketen, dem Gesang, sportlichen Höchstleistungen und vermutlich auch dem Internet bis hin zu ungeheuerlich zerstörerischen Schöpfungen wie Waffen, Atombomben, Giften, Folterinstrumenten und dem Krieg als einem der sicherlich verabscheuungswürdigsten menschlichen Konglomerate sehr spezifischer Tod und Verderben bringender Technologien und Techniken. Ja, in der Tat, es gibt viele ungeheure Dinge auf diesem Planten und viele davon, wenn auch sicherlich nicht alle wurden von Menschen in Gedanken entworfen und irgendwann in die Tat umgesetzt.
Darüber hinaus erfahren wir über die von Menschen kreierten ungeheuren Dinge auch viel über das vielschichtige und komplexe menschliche Wesen, das sich durch zahlreiche und zuweilen widersprüchliche charakterliche Merkmale und individuelle Züge auszeichnet.

In der Betrachtung eines Roboters etwa, der scheinbar wie von Geisterhand vollständig selbstständig bestimmte Tätigkeiten ausführt, mit uns spricht und manches vielleicht sogar besser kann als wir Menschen, bewundern wir zugleich auch menschliche Eigenschaften wie die Neugierde, Kreativität und sicherlich auch die Fähigkeit, sich zu kümmern und zu sorgen als den ernsthaften guten Willen, Sinnvolles und andere Menschen Unterstützendes zu erschaffen.

Stehen wir hingegen bspw. in Fukushima, wie ich im Mai 2019 im Rahmen der Dreharbeiten zu Marc Bauders Film Wer Wir Waren, sprach- und fassungslos angesichts all des Leids, dass diese Nuklearkatstrophe verursacht hat, sind wir auch entsetzt über die menschliche Gier nach Geld und Macht, über die vor nichts Halt machende Herrsch- und Kontrollsucht, über Ignoranz, Narzissmus und Arroganz der Menschen, was doch letztlich nur ihre ungeheure Erbärmlichkeit offenbart.
Und damit sind wir bei dem zweiten interessanten Bedeutungsaspekt des altgriechischen Zitats aus der Antigone angelangt, dass es nämlich wirklich sehr viele im Guten wie im Schlechten ungeheure Dinge gibt, all dies uns aber schließlich lediglich darüber Aufschluss gibt, dass das wohl ungeheuerste Wesen im Kosmos der Mensch selbst sein muss, der doch all die ungeheuren Dinge erschaffen hat. Nichts ist ungeheurer als dieses seltsame Wesen, wunderschön, mit gutem Herzen und den besten Intentionen und zugleich garstig und verachtenswert in seinen leider so zahlreichen dunklen Momenten.
Angesichts dieser Ungeheuerlichkeit des Menschen sind viele, die sich in Definitionen versucht haben, schlicht verstummt – manche erstaunt, andere aus Demut oder Angst. Zu unkontrollierbar, zu widersprüchlich und paradox schien ihnen der Mensch zu sein. Was bleibt uns denn noch zu sagen, welche Erklärungsversuche werden dem Menschen überhaupt gerecht, welche Prognosen erscheinen nicht einseitig und kurzsichtig, wenn doch ein eiliger Blick in die menschliche Geschichte die Wankelmut dieses Wesens offenbart, die unglaublichen Höhen, die es zwar zu erklimmen im Stande ist, die Abgründe aber, in die es sehenden Auges wiederholt herabsteigt. Andere, wie etwa die Religionen, sind sich in Drohungen ergangen – dabei immer optimistisch an dem großartigen Ungeheuren im Menschen festhaltend, das in der Lage sei, sich zu bändigen, das niederträchtige Ungeheure in sich zu unterwerfen und auf diese Weise der Hölle zu entgehen und in den Himmel ein- bzw. zurück zu kehren. Wieder andere, häufig Anthropolog*innen, versuchen entweder, die schlechten Seiten des Menschen als seine bloß schwachen Momente zu deklassifizieren, die vorbei gehen, wenn wir uns nur ordentlich bemühen, kultivieren, zivilisieren, anstrengen, domestizieren, züchtigen. Oder aber sie werden als eigentlich nichtmenschlich verdammt, als Formen der Ungeheuerlichkeit, in denen der Mensch sich selbst am fremdesten, von seiner wahren Natur am Weitesten entfernt, eben am Un- bzw. Nichtmenschlichsten ist.
So verfährt etwa eine der wirkmächtigsten anthropologischen Positionen in unseren Gesellschaften, nämlich der Humanismus. Der Humanismus, der auf dem altlateinischen Begriff der »humanitas« beruht, ist ursprünglich eine anthropologische Theorie, den Menschen als ein der Selbstkultivierung fähiges Wesen nicht nur von den nichtmenschlichen Tieren zu unterscheiden, sondern auch von den ›niederen‹ menschlichen Gestalten, den Barbar*innen. Der Mensch, so die antike humanistische Idee, ist nur dann Mensch, wenn er seine humanitats, also kultivierte, zivilisierte Philanthropie, trainiert und sich sein Leben lang um sie bemüht. Dann und nur dann ist der Mensch wirklich Mensch, wenn er ungeheuerlich in dem Sinne wird, dass er über sich selbst hinaus wächst, zu einem wunderbaren und großartigen Wesen wird und sich stets anstrengt, die Höhen, die seine Natur ihm auferlegt hat zu erreichen, auch nicht mehr zu verlassen. Tiere, Pflanzen, Maschinen und Barbar*innen sind deshalb keine Menschen, weil sie der (aufklärungshumanistischen) Vernunft, der Rationalität nicht fähig sind, die sich in Kunst, Wissenschaft und Kultur realisieren. Sie sind Ungeheuer im rein negativen und auch moralisch diskreditierenden Verständnis, ein Abfall, eine ekelhafte Entartung, eine Entfremdung.
Und damit sind wir bei dem dritten Bedeutungsaspekt des einleitend genannten Zitats aus der Antigone angelangt, dem Interpretationsmoment, das mich derzeit ohne Frage am Meisten umtreibt. Denn liegt nicht zugleich eine unglaubliche Arroganz in der Behauptung, dass das Ungeheuerste im Kosmos der Mensch ist – eine Behauptung, die von Menschen ja schließlich selbst getroffen wird?! Wie kommen wir denn bittschön dazu, das zu glauben, angesichts all der wundersamen Dinge, die um uns herum, auf diesem seltsamen Planeten, in diesem ganzen verrückten Universum tagtäglich passieren und die doch wenig bis gar nichts mit dem selbstbewussten kleinen Menschlein, das wir doch nur sind, zu tun haben. Sicher, nicht nur Philosoph*innen wie Friedrich Nietzsche waren bereits von diesem offenkundigen menschlichen Narzissmus, sich selbst für das unglaublichste Wesen zu halten, irritiert. Und es liegt mir nichts ferner als zu behaupten, ich würde mit dieser Feststellung der menschlichen Arroganz, die in einigen Kreisen auch als Anthropozentrismus bekannt ist, also die Annahme, dass ›der‹ Mensch die ›Krone der Schöpfung‹ darstellt, eine neue Erkenntnis formulieren.
Vielleicht bin ich einfach nur erstaunt, dass es die anthropozentrische Überheblichkeit schon so lange gibt und wir einfach nicht davon lassen wollen, obwohl wir uns davon doch wahrlich nichts ›kaufen‹ können. Damit will ich sagen, dass die Annahme, ›der‹ Mensch sei das wichtigste und moralisch bedeutsamste Wesen im Kosmos, ja noch nicht einmal dazu geführt hat (und das wäre ja wohl das Mindeste, was wir uns unter einer anthropozentrischen Prämisse erhoffen dürften), dass wir alle Wesen, die wir als Menschen anerkennen, gleichermaßen gut behandeln. Erst recht nicht hat der Anthropozentrismus dazu geführt, alles Nichtmenschliche allein deshalb, da es für die Menschen wichtig wäre (wie etwa die Natur, die Umwelt, die Vielfalt der Tier-, Pflanzen und Mineralwelt und so vieles mehr) gut zu behandeln.
Ich stehe in Fukushima am Wasser und blicke auf die Naturgewalten dieses Planeten, die sich die lächerlichen Errungenschaften der Menschen in kürzester Zeit wieder zurückerobern. Ich stehe in den Technikmuseen und Entwicklungseinrichtungen dieser Welt vor Robotern, die holperig menschliche Fähigkeiten zu imitieren versuchen (von denen ich mir noch nicht einmal sicher bin, ob sie wirklich so nachahmenswert sind).

Ich stehe in meinem Wohnzimmer und beobachte (im Fernsehen) die Astronaut*innen in ihrer unwirklichen Arbeit fern allen menschlichen Lebens, die doch immer notwendig bei der eigenen (menschlichen) Bedingtheit und Endlichkeit landen und vermutlich an ihr scheitern, die sich in der Abhängigkeit von Sauerstoff, Nahrung, Schlaf und Beziehungen äußert. Ich stehe am Ufer des Meeres und denke über die Anstrengungen der Tiefseeforscher*innen nach, die Unfassbares in den dunkelsten Abgründen dieses Planeten leisten und – wieder daraus ans Licht des Tages zurückgekehrt – uns davon berichten, dass das kleine menschliche Dasein umgeben ist von Organismen, nicht ganz Tier und nicht ganz Pflanze, die diesem in Lebensdauer, Wahrnehmungsmöglichkeiten und Überlebensfähigkeiten so immens überlegen sind, dass es an ein Wunder grenzt, dass wir es überhaupt bis ins Jahr 2021 geschafft haben.

Wie können wir uns nur für so wichtig halten?
Müssten nicht alle Außerirdischen, die unbenommen irgendwann die kläglichen Überreste der Menschen finden werden, in schallendes, alienhaftes Gelächter gar nicht einmal darüber ausbrechen, wer wir (tatsächlich) waren, sondern insbesondere darüber, für wen wir uns gehalten haben? Es gibt viele ungeheure Dinge, aber wahrlich, nichts ist ungeheurer als die menschliche Arroganz!
Sicher, es gibt Alternativen zum Anthropozentrismus. Aber bevor sich die Hoffnung Bahn bricht, mit der ich diesen Essay unbedingt zu beenden gedenke, muss ich direkt einwenden, dass auch diese Alternativen, zumindest die, die unsere Gesellschaften uns anbieten (ich maße mir nicht an, über alles Treiben auf diesem Planeten etwas sagen zu können, geschweige denn, etwas Sinnvolles), nicht viel besser sind. Es gibt ethische Positionen wie bspw. den Pathozentrismus, der nicht nur den Menschen, sondern allen leidensfähigen Wesen und damit also auch einigen Tieren den höchsten denkbaren Wert, den Wert, den im Anthropozentrismus lediglich Menschen erhalten, zuschreibt. Doch auch im Rahmen des pathozentrischen Denkens geben die Menschen den moralischen Standard ab, indem sie selbst es sind, die definieren, was Leidensfähigkeit ist und welche Tiere demzufolge nach dem menschlichen Verständnis von Leidensfähigkeit einzuschätzen und moralisch zu bewerten sind. Aus einer pathozentrischen Perspektive haben wir uns zwar vor der menschlichen Arroganz auf den ersten Blick hin gerettet, holen sie aber letztlich ›durch die Hintertür‹ der nach menschlichen Maßstäben definierten Leidensfähigkeit und dadurch, dass wir die nach menschlichen Maßstäben definierte Leidensfähigkeit als wichtigstes moralisches Kriterium einschätzen sowie dadurch, dass wir es sind, die einigen Tieren diese menschliche Leidensfähigkeit zuschreiben oder sie ihnen absprechen, wieder herein.
Vielleicht können wir nicht anders, werden einige von Ihnen nun erschöpft sagen. Vielleicht ist diese Weise ethischen Kategorisierens, Denkens und Urteilens, die für uns so selbstverständlich wie ein Naturgesetz ist, eben notwendig und deshalb unumgänglich. Vielleicht müssen wir einfach so vorgehen, dass wir irgendein Wesen definieren – ob nur den Menschen oder ein Wesen nach menschlichen Maßstäben –, das am Wichtigsten ist, um das sich alles in diesem Kosmos dreht. Vielleicht können wir nicht anders als auf diese Weise strukturell exkludierend und damit tendenziell diskriminierend zu verfahren, über die Definition eines wichtigsten Wesens alles andere abzuwerten, diesem einen lediglich niedrigeren Status zuzugestehen, der es uns gestattet, entsprechend mit ihm zu verfahren, es auszubeuten und zu unterwerfen. Vielleicht sind wir tatsächlich notwendig dazu verdammt, aufgrund unserer Konzentration auf das moralische Handlungssubjekt (was meistens eben exklusiv die Menschen meint) immer all die anderen (nichtmenschlichen) Wesen auszuschließen und moralisch abzuwerten, zu diskreditieren, zu diskriminieren?
Einem solchen Pessimismus möchte ich aufs Entschiedenste entgegentreten. Ethik ist kein Naturgesetz! Unsere Weise, die Welt zu sehen und alles in ihr zu ordnen, in Kategorien aufzuteilen und zu bewerten, ist zwar ohne Frage tief in uns verankert. Zweifellos müssen wir auch in vielen Alltagssituationen schnell darüber entscheiden, ob etwas bspw. ein Mensch oder ein Nichtmensch ist, unser Strafrecht baut auf dieser Unterscheidung, unser ganzes gesellschaftliches, politisches und ökonomisches Denken ebenso. So einfach entkommen wir dieser Sache, also dem anthropozentrischen Narzissmus und seinen Kammerad*innen wie dem Pathozentrismus, natürlich nicht. Das liegt vermutlich auch daran, dass das Ich eine lange Entwicklungsreise hinter sich hat. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Wesen, das wir »Ich« nennen und dem wir so prominente Eigenschaften wie Verantwortung, Autonomie, einen freien Willen, Selbstgesetzgebung, Vernunft, Rationalität, Selbstbewusstsein, vielleicht eine Seele, mindestens aber personale Identität und zahlreiche weitere Kompetenzen zuschreiben, erschaffen haben. Es heißt, dieses Ich habe in der Antike noch nicht in dieser Weise existiert. Damals haben sich die Menschen noch viel mehr als Spielbälle göttlicher Kräfte erlebt, nicht als autarke, selbstständige Wesen, die ihr Schicksal weitestgehend in den eigenen Händen halten. (Seltsam mutet vor diesem Hintergrund Sophokles‘ Äußerung in der Antigone über den Menschen als das ungeheuerste Ding im Kosmos an, aber das ist nur eine kleine irritierte Fußnote, die Sie getrost überlesen dürfen.) Wir, die Menschen, haben hart daran gearbeitet, uns als besondere Wesen, überhaupt als Wesen und als wertvolle Individuen, als Rechtspersonen mit einer vollen Verantwortung für das eigene Dasein sehen zu dürfen. Auf diesem Grundsatz baut – wie gesagt – unsere gesamte Gesellschaft, unser Rechtssystem, unser politisches, ökonomisches, religiöses und moralisches Denken, wichtige (fast) globale Errungenschaften wie die Menschenrechte und (weitestgehend) akzeptierte moralische und religiöse Grundsätze wie die, dass Mord etwas Schlechtes und Altruismus etwas Gutes ist, auf. Wollen wir das wirklich mit der Verabschiedung vom Anthropozentrismus und verwandter Positionen einfach über Bord werfen? Bzw. können wir es, selbst, wenn wir es wollten?
Mit der mir eigenen atemlosen und vielleicht naiven Impulsivität versuche ich mich in den letzten mutigen Zeilen dieses Essays in einem utopischen Ja! Es ist ein utopisches Ja, das sich wieder auf die Reise begibt – diesmal allerdings nicht auf die Reise zum richtigen oder korrekten menschlichen Wesen, an das ich eh nicht glaube. Sondern vielmehr verspricht mein utopisches Ja eine Suche – nicht nach der richtigen oder korrekten Definition vom Menschen oder nach anderen (nichtmenschlichen) Wesen, die wir zu neuen Freund*innen erklären können, denen wir doch letztlich wieder nur nach unseren eigenen traurigen Maßstäben irgendeinen Wert zuschreiben. Denen wir dann auch Kompetenzen attestieren, denen wir Verantwortung auferlegen und Selbstbewusstsein aufzwingen, denen wir ein Ich schenken. Danke, Mensch… Denn jede neue Theorie vom moralischen Handlungssubjekt produziert wieder neue Ausgeschlossene, jene, die wir nicht in unseren Reihen wissen wollen. Und das muss wohl oder übel auch so sein, denn hätten alle Wesen, menschliche wie nichtmenschliche, einen moralischen Eigenwert, wären also alle Wesen die wichtigsten Wesen im Kosmos, wäre moralisches Handeln schlicht unmöglich. Und gäbe es nichts, was moralisch irrelevant ist, würde vermutlich jede Situation, in der moralisches Handeln gefordert wäre, zu komplex und undurchsichtig, als dass wir ohne allzu viel nachdenken zu müssen, wüssten, was von uns jeweils moralisch gefordert ist.
Es hilft nichts, wir müssen anders vorgehen. Mein Ja ist deshalb eine Utopie, weil positive Visionen von unserer Gesellschaft so dringend nötig sind in dieser Zeit, in der wir in Filmen und Serien ausschließlich Dystopien vorgehalten bekommen, also Zukunftsszenarien, die Möglichkeiten vorstellen, wie unsere Welt unweigerlich zum Teufel gehen wird, wenn wir nichts ändern. Und schlimmer, wir brauchen gar nicht Netflix, sondern schlicht die Tagesnachrichten, um über unseren zielstrebigen Weg in den Abgrund aufgeklärt zu werden.
Stellen wir uns im Gegensatz dazu einmal vor, wir würden diesen so tief in uns verankerten Fokus auf das moralische Handlungssubjekt, der immer und immer wieder in uns Exklusions- und Diskriminierungsbewegungen provoziert, radikal verschieben. Aber wohin denn nur sagen all jene, die mir bis hierher willens waren zu folgen, die vielleicht müde zwischendurch ein paar Zeilen übersprungen haben oder wütend mit den Zähnen knirschen? Wenn die Relata, also die Subjekte, diese kleinen Ichs, um die wir doch so lange gekämpft haben, nicht mehr im Mittelpunkt stehen, wer oder was kann es denn dann bitteschön? Nun, mein Vorschlag wäre, es einmal mit einer Konzentration auf die Beziehungen, die Relationen, zu versuchen. Nicht die Subjekte sind den Beziehungen, die sie miteinander eingehen, vorgängig, denn es gibt schlicht keine autonomen, autarken, monadischen Subjekte. Es ist lediglich unsere Arroganz, die uns das vorgaukelt. Sondern die Beziehungen erschaffen erst das, was wir rein oberflächlich als selbstständige Subjekte erkennen. Oder, wie es die zwei kritischen Posthumanistinnen Karen Barad und Donna Haraway sagen, »Beziehungen hängen nicht von ihren Relata ab, sondern umgekehrt.« (Barad) »Wesen […] existieren nicht vor ihren Verhältnissen und Beziehungen.« (Haraway) Lesen Sie diese letzten Sätze noch mindestens zwei Mal, bevor Sie fortfahren. Lassen Sie es sich ganz genau auf der Zunge zergehen. Es ist tatsächlich einigermaßen radikal, was ich mit Hilfe der Zungen von Barad und Haraway versuche zu sagen.
Wenn wir eine Ethik formulieren, die nicht mehr darauf baut, moralische Individuen zu definieren, sondern die sich auf Beziehungen richtet, würde sich sicherlich einiges ändern. Und ohne Zweifel ergäben sich aus dem fluiden, dynamischen Subjekt, das sich ständig wandelt und abhängig von einer konkreten Beziehung immer anders aussehen kann, auch große Herausforderungen. Aber Utopien realisieren sich nun mal nicht von allein. Wir müssen uns für sie einsetzen und uns irgendwann auf den Weg, der zu ihnen führt, begeben. Ich stelle mir eine Welt, in der es nicht um Freund*innen, sondern um Freundschaften, nicht um Gefährt*innen, sondern um Gefährt*innenschaften, geht, sehr schön vor. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der es keine Rolle mehr spielt, wie sich diejenigen, die in Beziehungen eingebunden sind, verstehen – ob als Menschen, Tiere, Maschinen, Pflanzen oder als was auch immer. Sondern mich interessiert, was das für Beziehungen sind, durch die ›sie‹ überhaupt erst entstehen. Eine Gesellschaft der Freundschaften und Gefährt*innenschaften – das ist meine Utopie einer inklusiven Ethik.
Auf diese Weise verschiebt sich der Fokus von dem »Wer wir waren« auf das »Wer wir waren«. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will das handelnde Subjekt nicht wegrationalisieren, es ist in dem »Wer wir waren« ja auch immer noch vorhanden. Es steht nur nicht mehr an erster Stelle. Besagte Außerirdische, die unbenommen irgendwann in dem staubigen Wind dieses Planeten stehen werden, brechen dann vielleicht nicht mehr in schallendes, alienhaftes Gelächter über diese unfassbar arrogante Spezies aus. Es gibt zwei in meinen Augen (und ja, ich lebe natürlich noch in einer Gesellschaft, in der es unumgänglich ist, darauf hinzuweisen, dass es meine Augen sind) hoffnungsvolle Möglichkeiten, wie die Aliens (als die ich sie gerade nur zu sehen in der Lage bin) einer fernen Zukunft (wir brauchen realistischerweise noch ein wenig Zeit, bis wir in meiner atemlosen Utopie angelangt sind) auf dem Planeten Erde landen könnten. Zum einen mit der Frage, nicht etwa danach, wer wir waren, sondern danach, was hier passiert ist, welche Beziehungen sich entwickelt haben, welche Strukturen darauf aufbauend gebildet wurden. Zum anderen – und das ist mindestens die Hoffnung, mit der ›ich‹ auf die ›Aliens‹ einer vermutlich noch weit entfernten Zukunft und das Urteil, das ›sie sich‹ bilden würden, blicke – erkennen sie, dass »wir« diejenigen »waren«, die sich auf den Weg begeben haben, auf die Suche nach einer echten Alternative. Dass ›wir‹ diejenigen waren, die den wirklichen Versuch unternommen haben, eine bessere Welt zu schaffen. Eine Welt, die gerade deshalb besser ist, weil es kein »uns« mehr gibt, um das es geht, in der »wir« also genau genommen gar nicht ankommen werden. Eine Welt, in der es vollkommen irrelevant ist, nicht nur, ob ich Frau, Mann oder queer (also was für ein spezifischer Mensch ich) bin, sondern ob ich überhaupt ein Mensch, ein Tier, eine Pflanze, eine Maschine oder was auch immer bin. Wollen Sie versuchen, sich das mit mir vorzustellen?
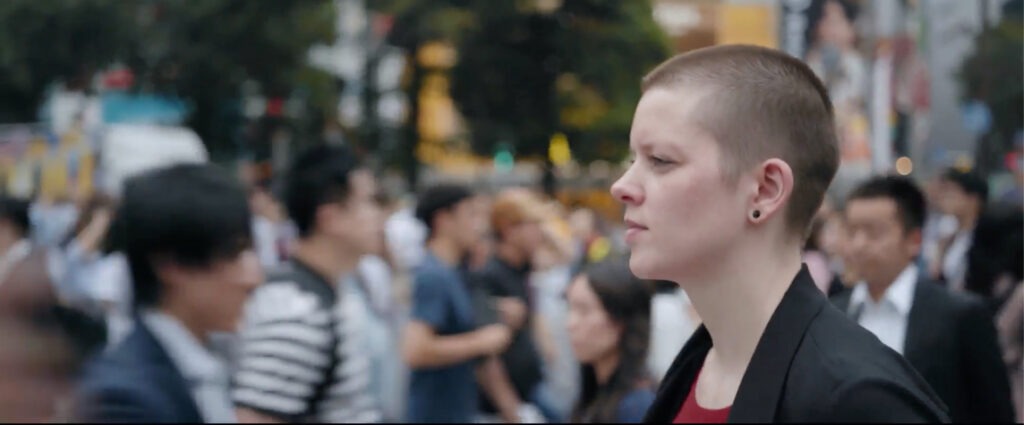
Ich würde für diese Utopie der Gefährt*innenschaft sogar meine Autor*innenschaft an diesem Text abgeben – und das ist etwas, was akademische Philosoph*innen nur äußerst ungern tun. Bitte erlauben Sie mir dieses kleine Augenzwinkern am Ende dieses ernsten Textes als ein eiliges Luftholen, bevor es wieder in die wichtigen Gewässer einer zukünftigen Gesellschaft abzutauchen gilt. Ich glaube, dass das Ich, das wir erschaffen haben, längst nicht so toll ist, wie wir glauben, denken oder hoffen. Und dass es keine Möglichkeit gibt, es besser zu machen, so sehr ›wir‹ uns auch anstrengen mögen. In einem Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten im Fach Philosophie habe ich vor vielen Jahren einen Leitsatz gelernt, nämlich den des »Killing your Darlings«. Damit soll gesagt sein, dass wir manchmal ganz vermeintlich großartige Ideen haben, die wir unbedingt in unseren Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Master-, Magister-, Diplom-, Doktorarbeiten, Habilitationsschriften und anderen Texten unterbringen wollen. Dann fangen wir an, alles andere in dem Text um diesen Satz, der unsere vermeintlich bahnbrechende Erkenntnis enthält, herum aufzubauen. Und sehen dabei nicht, dass unser Darling im besten Fall nichts mit dem eigentlichen Anliegen unseres Projekts zu tun hat und im schlimmsten Fall leider einfach Quatsch ist. Vielleicht ist das Ich ein solcher Darling, an dem wir unser gesamtes Narrativ orientieren, den wir aber leider streichen müssen. Wenn auch nicht streichen in dem radikalen Sinn eines Auslöschens, sondern vielmehr in dem Abrücken des Fokus, dem Absprechen der Bedeutung, was mit einem Verrücken der Perspektive von den Relata auf die Relationen unweigerlich einhergehen würde.
Würde Marc Bauder diesen Film in der Zukunft meiner atemlosen Utopie drehen, hieße er vermutlich nicht Wer wir waren sondern Was passiert ist. Und es gäbe keinen Marc Bauder, der ihn drehen würde, sondern es wäre ein Film, der ein hypostasiertes Netz an Beziehungen zeigen würde, entstanden zu einer ganz spezifischen Zeit an ganz spezifischen Orten unserer alten Welt mit einer zufälligen aber konkreten Reihe unterschiedlichster Akteur*innen, deren Namen nicht bekannt sind und nicht gebraucht werden, um das Gute und das Schlechte zu zeigen, das die Geschichte dieses Planeten zu einer bestimmten Zeit geprägt und zu eben diesem Planeten gemacht hat. Mir würde das genügen. Aber… wer bin ich schon? Oder?
Marc Bauders Kinodokumentarfilm Wer Wir Waren (Who We Were) feiert Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale! Und ab 22.4., dem World Earth Day, dann in den deutschen Kinos: https://www.bauderfilm.de/wer-wir-waren
Janina Loh ist PostDoc im Bereich Technik- und Medienphilosophie der Universität Wien. Zu ihren engeren Forschungsinteressen zählen der Trans- und Posthumanismus, Roboterethik, feministische Technikphilosophie, Verantwortungstheorien, Hannah Arendt, Theorien der Urteilskraft und Ethik in den Wissenschaften.




