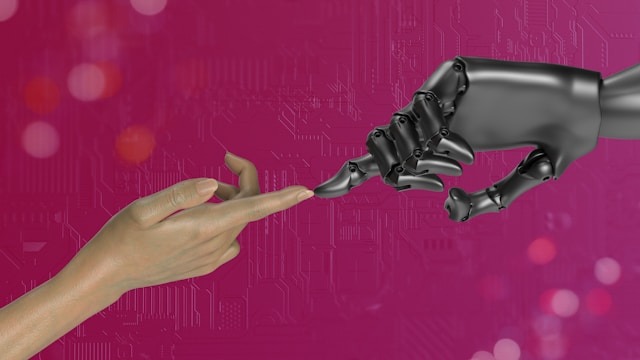Zur double bind-Paradoxie der repräsentativen Demokratie
Von Martin Welsch (Heidelberg)
In der Publizistik ist es ein Gemeinplatz, dass sich die repräsentative Demokratie in einer Krise befindet, Politikverdrossenheit und Massenproteste werden als Zeichen dafür gewertet. Die politik- und sozialwissenschaftliche Theorie dieser Krisendiagnose ist die der „Postdemokratie“: Das Repräsentativsystem habe früher seinen demokratischen Zweck erfüllt, doch diese Zeit sei vergangen. Derzeit gleiche sich das System wieder dem vordemokratischen Zustand an, sodass die Demokratie zur leeren Hülse werde. Für Vertreter der Postdemokratiethese liegt dies jedoch nicht am Repräsentativsystem selbst; seine Degeneration sei äußerlich bedingt, nach Ansicht von Colin Crouch durch Wirtschaftsmacht.
Die Rede von der Krise der repräsentativen Demokratie ist allerdings nicht neu, man denke etwa an die Debatten der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Vielmehr gibt es Anlass anzunehmen, dass sie grundsätzlicher Art ist. Eine solche Diagnose hat der italienische Philosoph Giuseppe Duso als Ergebnis seiner ideengeschichtlichen Forschung vorgelegt:[i] Ihm zufolge ist die Logik der modernen demokratischen Repräsentation in Wahrheit eine autoritäre. So gesehen konnte die repräsentative Demokratie niemals etwas anderes gewesen sein als das, was man heute als „Postdemokratie“ bezeichnet.
Autoritär ist die repräsentative Demokratie demnach, insofern ihr Prinzip der Repräsentation dasjenige der Repräsentation qua ‚politischer‘ Autorisation ist. Gegenwärtig ist dieses Prinzip in jeder demokratischen Verfassung verankert, mag sie eine repräsentative Demokratie konstituieren wie die Bundesrepublik Deutschland oder eine semi-direkte, wie die Schweiz: Durch den periodisch erfolgenden (Wahl-)Akt der Autorisation übertragen die Staatsbürger ihre Kompetenz politisch zu handeln auf Repräsentanten und werden dadurch zugleich zu Autoren von deren Handlungen. Damit tragen vorrangig die Staatsbürger die Verantwortung für das Tun und Lassen der Stellvertreter. Das aber hat absurde Konsequenzen:[ii] Protestieren die Staatsbürger gegen ihre Repräsentanten, so protestieren sie gegen sich selbst; herrscht unter ihnen Politikverdrossenheit, so sind sie nur ihrer selbst überdrüssig; lehnen sie sogar in Form eines Volksentscheids ein Gesetz ab, das ihre Vertreter kürzlich über sie beschlossen haben, so diskreditieren sie ihre eigene Gesetzgebung.
Aufgrund dieser Logik ist das moderne Prinzip der Repräsentation nicht lediglich dem Prinzip der Volkssouveränität beigeordnet, sondern es ist selbst dieses: Zwar haben die Staatsbürger ihre Kompetenz politisch zu handeln auf ihre Repräsentanten übertragen, doch die Handlungen der politischen Akteure sind auf die Willen der Staatsbürger zurückzuführen und ihnen zuzurechnen. Obwohl sie also unfähig sind, de facto politisch zu handeln, sind und bleiben sie de jure die einzigen politischen Akteure im Staat. Allein das Volk ist der Souverän. Politisches Handeln ist aber nicht irgendein Handeln, es besteht in der Ausübung der Staatsgewalt. Diese soll als höchste Gewalt – Souveränität – über allen Einzelwillen stehen und sie jederzeit brechen können. Damit erstreckt sich der politische Autorisationsakt nicht nur auf ein klar abgrenzbares Handlungsfeld (politische Autonomie), sondern er richtet sich auf die Kompetenz letztinstanzlicher Selbstbestimmung in toto (Autonomie überhaupt).
Giuseppe Duso deckt mit seiner Studie zum modernen Prinzip der Repräsentation jedoch nicht nur eine dunkle Seite demokratischer Verfassungen auf, sondern diskreditiert das demokratische Projekt in der Tradition von Carl Schmitt als Ganzes. Nach Duso ist es grundsätzlich unmöglich, den Gedanken der Volkssouveränität von der Dominanz der Repräsentation zu lösen. Damit verkennt er meines Erachtens allerdings das normative Potential der Demokratie wie auch die eigentliche Ursache ihrer Krise. Demokratien fußen nämlich weniger auf dem Gedanken der Repräsentation qua Autorisation als vielmehr primär auf dem Gedanken der öffentlich-rechtlichen Autonomie des Volkes. Das Recht dazu wird den Menschen durch jede demokratische Verfassung zugestanden. Zudem wird ihnen durch politische Bildung von klein auf nahegebracht, es sei ihre Pflicht, dieses Recht auch wahrzunehmen: Volkssouveränität soll von den Staatsbürgern aktiv ausgeübt werden. Wenn Staatsbürger nun, beispielsweise in einer Demonstration, die Autorität ihrer Willensäußerungen gegen ihre Repräsentanten geltend machen, so tun sie genau dies. Obwohl die Bürger also über den Akt der Autorisation hinaus nicht weiter politisch handeln können und sollen, wird genau dies von ihnen erwartet. Im juristischen Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung ist ihnen jedoch fortan weder möglich, tatsächlich in letzter Instanz politisch zu handeln, noch auf die politisch Handelnden einzuwirken, ohne einen radikalen Selbstwiderspruch zu begehen. Sie haben die Kompetenz dazu schließlich rechtskräftig delegiert, diese wird an ihrer Stelle in ihrem Namen ausgeübt und sie gelten fortan als die Autoren dieser Ausübung. Folglich haben sie hiergegen auch nichts geltend zu machen. Die Rationalität der ‚politischen‘ Autorisation und Repräsentation verlangt, dies sein zu lassen.
Demokratien der Gegenwart setzen ihre Staatsbürger somit einer irrationalen, da nicht zu erfüllenden Doppelverpflichtung aus (double bind): Einerseits sollen die Staatsbürger Volkssouveränität ausüben, andererseits aber genau das auch unterlassen. Dadurch destabilisieren sich moderne Demokratien selbst. Letztlich handelt es sich hierbei um ein verfassungsrechtliches Strukturproblem, nämlich wie die zwei tragenden Prinzipien moderner Demokratie – Volkssouveränität und Repräsentation – zu ordnen sind: Das Prinzip der Volkssouveränität wird gegenwärtig dem Prinzip der Repräsentation in concreto untergeordnet, weil die Autorisation eine Absorption der Volkssouveränität bewirkt. Und darum soll die Volkssouveränität nicht nur ausgeübt, sondern zugleich nicht ausgeübt werden, zumindest nicht über den Akt der Autorisation hinaus. Das kennzeichnet die double bind-Paradoxie.
Befragt man die politische Philosophie der Gegenwart nach einem konstruktiven Vorschlag diesbezüglich, so wird man nicht fündig. Insofern sie die repräsentative Demokratie bejaht, liegt ihr weitreichendster Vorschlag in der punktuellen Ergänzung des Repräsentativsystems durch plebiszitäre Entscheidungsverfahren. Doch mit diesem Vorschlag wird die problematische Struktur noch nicht einmal angetastet.
Reflektiert man die Ideengeschichte repräsentativer Demokratien, so ist es immerhin möglich, die Struktur des Problems zu verstehen. Dazu drei Punkte: Erstens wird erkennbar, dass das Prinzip der Repräsentation qua Autorisation für sich genommen ein dezidiert antidemokratisches rechtstechnisches Instrument ist. Das lässt sich einsehen, wenn man seine Spuren von den modernen Verfassungen aus über Sieyes und Locke zu Hobbes zurückverfolgt. Denn Repräsentation qua ‚politischer‘ Autorisation ist das ultimative Instrument in Hobbes’ autoritärer Staatsphilosophie, weil es Freiheit als letztinstanzliche Selbstbestimmung neutralisiert.
Mit diesem Instrument richtete sich Hobbes gegen die Forderungen seiner Zeitgenossen, um der Freiheit willen müsse man eine demokratische Staatsform etablieren.[iii] Nämliche Forderung wurde im Zuge der Rehabilitation eines Freiheitsverständnisses laut, das in den Digesten des Römischen Rechts festgehalten ist. Diesem Verständnis zufolge hört man auf, ein echter handlungsfähiger Akteur zu sein, sobald man unter der Herrschaft eines Anderen steht. Falle die Selbstbestimmung in letzter Instanz weg, so sei auch alle Handlungsfreiheit (nach dem Paradigma physikalischer Bewegungsfreiheit) bedeutungslos. Diese Logik mache letzten Endes, so die offizielle Propaganda des Unterhauses im Jahr 1649, die demokratische Staatsform notwendig. Um dem zu kontern hatte Hobbes im ›Leviathan‹ den Freiheitsbegriff der Tradition unter der Hand zu demjenigen der Handlungsfreiheit umgedeutet.[iv] Freilich, diese Umdeutung war „enorm polemisch und in der Tat epochemachend“ – doch meines Erachtens ist sie bei weitem nicht „die ungeheuerlichste Unverfrorenheit im gesamten Leviathan“, wie Quentin Skinner behauptet.[v] Denn Hobbes führt mit dem Instrument der Autorisation außerdem noch eine Struktur ins Feld, die den gegnerischen Freiheitsbegriff letztinstanzlicher Selbstbestimmung absorbiert: Einerseits dient Hobbes die Autorisation als Maske, die der Gegenseite suggeriert, letztinstanzliche Selbstbestimmung sei gegeben, was im Grunde auch der Fall ist. Andererseits ist die Autorisation aber auch die (Realisations-)Form, durch welche Selbstbestimmung de facto verhindert wird. Die Idealisierung der Freiheit letztinstanzlicher Selbstbestimmung, welche die ‚politische‘ Autorisation bewirkt, soll sie faktisch wirkungslos machen. Auf solch einer Autorisation beruht nach Hobbes[vi] allerdings jeder Staat, selbst die Demokratie.
Zweitens kann man einsehen, dass das Prinzip der Volkssouveränität mit dem modernen Prinzip der Repräsentation unverträglich ist: wenn man ersteres auf Rousseaus gegen Hobbes gerichtete Staatslehre zurückführt. Rousseau geht nämlich davon aus, dass man erst Hobbes’ pseudodemokratisches Prinzip der Repräsentation wieder in einer staatsbürgerlichen Praxis der Volkssouveränität auflösen muss, damit Volkssouveränität auch in einem affirmativen Sinn wirklich und wirksam werden kann – und mit ihr die alte Freiheit letztinstanzlicher Selbstbestimmung. Hobbes ließ das Prinzip der Volkssouveränität in der Struktur der Repräsentation qua Autorisation absorbieren; Rousseau dagegen will die Repräsentation in der Volkssouveränität auflösen. Die Volkssouveränität wäre dann wieder entidealisiert und die Repräsentation auf den Nullpunkt faktischer Selbstrepräsentation zurückgeführt: „le Souverain […] ne peut être représenté que par lui même“[vii].
Studiert man die Schriften des Abbé Sieyes, lässt sich aber auch drittens verstehen, warum beide Prinzipien den Verfassungen europäischer Demokratien gegenwärtig nur in Form jener problematischen Beiordnung innewohnen. Denn Sieyes übernahm Rousseaus Lehre von der politischen Autonomie des Volkes, gliederte ihr jedoch wieder Hobbes’ Prinzip der Repräsentation qua ‚politischer‘ Autorisation ein. Wenig verwunderlich ist dabei, dass Sieyes’ Rechtfertigung des „système représentatif“ argumentativ nicht von der (alten) Freiheit letztinstanzlicher Selbstbestimmung ausgeht, sondern lediglich von der (neuen) Hobbes’schen Handlungsfreiheit.[viii] Trotz aller deklarierten Volkssouveränität haben die Menschen darum in Sieyes’ Staat jenseits von Akten der Delegation „keinen besonderen Willen geltend zu machen“.[ix] Mit dieser Strukturentscheidung hatte sich Sieyes bekanntlich in den Verfassungsdiskussionen der Französischen Revolution gegen die Vertreter des Rousseau’schen Standpunktes durchgesetzt. So nahm Hobbes’ anti- und pseudodemokratisches Prinzip Einzug in die Verfassungen moderner Demokratien.
Die Genealogie des gegenwärtigen Verfassungsproblems ist also äußert aufschlussreich, weil durch sie nicht nur der historische Ursprung der double bind-Paradoxie aufgedeckt, sondern zugleich deren Problemstruktur deutlicher wird: In modernen Verfassungen koexistieren im Rahmen eines Verfassungssystems zwei Philosophien der Volkssouveränität, die einander widerstreiten, da sie Ausdruck diametral entgegengesetzter Wertschätzungen der Freiheit letztinstanzlicher Selbstbestimmung sind. Die eine bejaht sie, die andere verneint sie.[x]
Dr. Martin Welsch ist Gastwissenschaftler am Interdisciplinary Centre of European Studies der Europa-Universität Flensburg. Er arbeitet zur Rechts- und Staatsphilosophie, der Philosophischen Rhetorik, Aufklärung und Anthropologie sowie zur Kritischen Theorie.
[i]Giuseppe Duso, Die moderne politische Repräsentation: Entstehung und Krise des Begriffs, Berlin 2006, hier: 18-29, 62-64, 85 f., 96-100, 107, 112-114, 122, 161-169.
[ii]Vgl. Quentin Skinner, Freiheit und Pflicht. Thomas Hobbes’ politische Philosophie, Frankfurt am Main 2008, hier: 108 f.
[iii]Vgl. Skinner, Freiheit und Pflicht, 11-14, 45 f., 95, 97 f.
[iv]Hobbes, Leviathan, Kap. 21, Skinner, Freiheit und Pflicht, 97 f.
[v]Skinner, Freiheit und Pflicht, 97.
[vi]Hobbes, Leviathan, Kap. 17 und 21.
[vii]Rousseau, Contrat Social, Buch II, Kap. 1.
[viii]Sieyes, Des intérêts de la Liberté dans l’état social et dans le système représentatif, in: Journal de l’instruction social, 2, 1793, 33-48.
[ix]Sieyes, Dire le l’abbé Sieyès, sur la question du veto royal, Paris 1789, hier: 15 f.
[x]Entnommen wurden und weitergeführt werden diese Überlegungen in meiner Kant-Monographie: Martin Welsch, Anfangsgründe der Volkssouveränität. Immanuel Kants ‚Staatsrecht‘ in der ›Metaphysik der Sitten‹, Frankfurt am Main 2021.