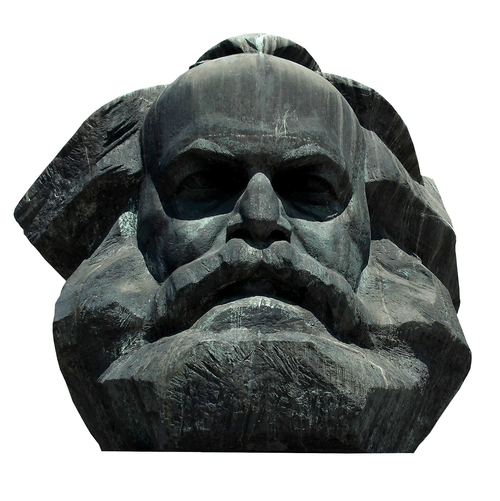
Was uns der Postmarxismus über den Staat sagen kann
von Cornelia Bruell (Baden bei Wien)
„Jawohl, ich erspare mir eine Theorie des Staates, ich will und muss mir eine Theorie des Staates ersparen – so wie man sich eine ungenießbare Mahlzeit ersparen kann und muss.“ (Foucault 2000, S. 69)
Ganz so sahen und sehen es nicht alle Postmarxist*innen, auch wenn ihnen genau das oft zum Vorwurf gemacht wird. Welches Staatsverständnis prägt also den Postmarxismus? Dafür müssen wir zunächst ein paar Worte aufwenden, um diese schwierige Strömung zu umreißen, denn gerade jene, die dieser Theorierichtung zugerechnet werden, erkennen selbst mehr Differenz als Gemeinsamkeit in ihrem Schaffen. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen der Theoriebildung, meist epistemologische, die ihnen doch gemein sind. Zunächst gehen sie von einem Konstruktivismus aus, der den Diskursbegriff gerade zur Wahrheitsbildung als zentral erachtet. Auch wenn der Diskursbegriff ganz unterschiedliche Schattierungen aufweisen kann, so sind sich Postmarxist*innen doch darin einig, dass es sich bei einem Diskurs nicht um ein geschlossenes System handelt, da selbst die notwendige Referenz auf ein Außen, das System schon wieder in Bedrängnis bringen kann und damit unabschließbar macht. Mit dieser These geht einher, dass es keine völlig geschlossene und stabilisierte Identität und in Folge dessen auch nicht DIE Gesellschaft im Singular geben kann. Genau diese Unabgeschlossenheit aber bereitet den Boden für das Politische. Denn das Politische wird notwendig, um die Struktur prekär zu schließen, es ermöglicht erst die sowohl das Selbst, als auch das System konstituierende Entscheidung.
Einig sind sich Postmarxist*innen auch darin, dass sie an Marx Theorie den historischen als auch ökonomischen Determinismus ablehnen und auch der sicheren Erwartung der Weltrevolution skeptisch gegenüber stehen. Schon viel weniger einig sind sie sich darin, ob nun der Klassenbegriff beibehalten werden sollte, jedenfalls lehnen die meisten die Privilegierung eines revolutionären Subjekts ab. Kämpfe müssen und werden vielfältig gedacht. Laclau und Mouffe definieren den Postmarxismus schlussendlich als die „Auf/Nachzeichnung der Genealogie des Marxismus, die Konstruktion der Geschichte eines ‚Präsenten‘“, durch die dem „Marxismus seine Gegenwart und Historizität“ zurückgegeben werden soll. (Laclau/Mouffe 1991, S. 17)
Gemeinsam ist diesen Theorien auch, dass ihnen eine Vernachlässigung sowohl der ökonomischen Bedingungen des Kapitalismus, als auch die Bedeutung politischer Institutionen und des Staates zum Vorwurf gemacht wird. Dabei wird oft übersehen, dass in postmarxistischen Theorien Institutionen zuallererst durch hegemoniale Artikulationen hervorgebracht werden und ihnen damit keine außer-diskursive Substanz zugesprochen wird. Folgerichtig sind auch die Reartikulationen des Staates immer historisch und fluid. Dennoch lassen sich einige staatstheoretische Positionen im Postmarxismus finden. Sehen wir uns diese genauer an (jüngste Veröffentlichung hierzu: Bruell/Mokre 2018).
Was ist der Staat?
Zunächst weist der Staat aus vielen postmarxistischen Perspektiven etwas Statisches, Festes, Geronnenes auf. Dies kann unterschiedlich umschrieben werden: als die symbolische Matrix der gesellschaftlichen Beziehungen, als das instituierte Gesellschaftliche, als das konkrete Verhältnis zwischen Herrschaft und Unterwerfung, als der gefrorene Zustand des Konflikts, als das Sichtbare und das Sagbare, oder instrumentelle Gewalt, Territorialisierung und Codierung.
Allerdings erscheint der Staat als äußerst ambivalent Geronnenes, denn er ist gleichzeitig außerhalb und innerhalb der Gesellschaft, als Repräsentant der herrschenden Klasse und als Regulativ der Klassenkämpfe; er ist gleichzeitig historisch und überdauert doch historische Konjunkturen; er wirkt individualisierend (z.B. über die Biopolitik) und totalisiert doch in Bezug auf Nation oder Volk; er setzt auf Machterhalt und Dauer und muss dennoch Bewegung im Spiel der Kräfte ermöglichen.
Der Staat ist so einerseits eine zum Mythos erhobene Abstraktion, er wirkt aber real strukturierend bis hinein in die Körper. Obwohl der Staat eine Schutz- und Sicherheitsfunktion übernehmen will, ist der Staat gerade im Kapitalismus durchzogen von Gewalt: er organisiert Ausbeutungsverhältnisse, er wirkt über Disziplinierung, er hat (teilweise) die Gewalt über die Produktion und über sozio-politische Entscheidungen.
Wer ist der Staat?
Der Staat entsprang der Revolte der Bourgeoisie gegen den Feudalismus im Namen einer behaupteten Universalität, nämlich dem Volk. Über diesen Gründungsmythos erreichte die Bourgeoisie ökonomische Dominanz. Seitdem dient das Volk der Legitimation des Staates und konstituiert sich als Macht nur mehr dann, wenn es revoltiert. Gleichzeitig produziert der Staat über Ausschlüsse Akteure, die einen Ort schaffen, von dem aus der Staat angegriffen werden kann: Migrant*innen, Staatenlose, die das Konzept von begrenzter Räumlichkeit in Frage stellen, das nackte Leben, als Anspruch auf Herrschaft derer, die keinen Anspruch haben.
Was ist nicht Staat?
Das Politische ist, was den Staat disloziert und selbiger wiederum zu unterdrücken versucht. Es wird durch die Wahl in eine legitime Form gebracht. Der Staat und das Politische gehen so ein zirkuläres Verhältnis ein: ohne das Politische kein Staat, der als geronnene Form des Streits verstanden werden kann und umgekehrt, ohne eine Sedimentierung des Sozialen keine Möglichkeit für das Politische, dislozierend in Erscheinung zu treten. Das Politische tritt also als Ereignis auf, unterbricht den Staat, ist weder präsentierbar noch lokalisierbar.
Es wäre also ganz im Gegenteil zum allgemeinen Verständnis durchaus möglich, den Staat als ein essentielles Element des Postmarxismus zu verstehen, da ohne eine feste Struktur auch das Widerständige kaum zu denken wäre. Zudem, wenn der Staat als Form verstanden wird und das Leben des Volkes als Tun, dann braucht es einen öffentlichen Raum, in dem diese beiden Dimensionen stets konflikthaft aufeinandertreffen können. So gesehen, kann der Rückzug des Staats heute in einigen Bereichen, in denen Privatwirtschaft und Lobbyismus vorherrschend sind, parallel zum Schwinden einer politischen Öffentlichkeit gelesen werden. Ebenso kann die Entpolitisierung erklärt werden: wenn die Zivilgesellschaft dafür zuständig ist, dem Politischen immer wieder an die Oberfläche zu verhelfen und den Ort der Macht leer zu halten, dann braucht auch sie genug Spielraum, um diese Aufgabe ausführen zu können. Kurz: weniger Staat, weniger politisierte Gesellschaft. Die Tendenz einer Rückkehr des Staates mit seinem eindeutigen Gewaltmonopol in einigen europäischen Ländern müsste so unweigerlich in eine Repolitisierung der Öffentlichkeit münden, was mancherorts bereits zu spüren ist.
Wohin mit dem Staat?
Die Frage der Eroberung oder Auflösung des Staates ist eine schwierige im Postmarxismus. Michael Hardt und Antonio Negri zum Beispiel sehen den Staat im Empire bereits in der Auflösung begriffen. Die jüngsten Tendenzen zur Renationalisierung mit eindeutig staatlicher Gewalt würden sie eventuell als ein letztes Aufbäumen fassen.
Einer Übernahme des Staates wird aus postmarxistischer Sicht meist skeptisch begegnet. Zu groß wäre die Gefahr, die vorhandenen Strukturen dadurch einfach zu übernehmen. Viel mehr wäre für Jean-Luc Nancy eher das Konzept der fortlaufenden Störung sinnvoll. Der Nationalstaat ist für die meisten Postmarxist*innen zwar eine höchst hinterfragbare Kategorie, aber eine minimale abstrakte Struktur ist für den politischen Kampf zentral. (Ausnahmen sind hier Alain Badiou und John Holloway, die zur Auflösung des Staates keine Alternative denken können.)
Schlussendlich lässt sich noch aufgrund der Basis des postmarxistischen und poststrukturalistischen Gesellschaftskonzeptes, dem jeglicher Grund fehlt, in dem jede Gründung und Stabilisierung auf Kontingenz beruht, kritisch fragen: wer tritt noch, in vollem Bewusstsein der Nicht-Notwendigkeit, emphatisch für politische Forderungen ein? Die politisch strategisch bisher beste Lösung für dieses intellektuelle Problem scheint Gayatri Spivak liefern zu können: es muss ein „strategischer Essentialismus“ vertreten werden, d.h. im Bewusstsein, dass es keine Substanz, keine essentielle Identität gibt, verhält man sich im politischen Streit so, als würde es sie geben – ein „Als ob“.
Für die Theorie aber gilt: Vielleicht muss gerade das postmarxistische Denken ein singuläres bleiben, im leeren Raum stattfinden, außerhalb des Staates, um als Bruch, als ein politisches Moment immer wieder dislozierend wirken zu können. Und vielleicht stellt sich so die Kritik der Staatsvergessenheit in dieser Denktradition als heimliche oder unbewusste Strategie heraus, den Postmarxismus als Motor politischer Bewegungen am Leben halten zu können.
Dr.in Cornelia Bruell ist Politikwissenschaftlerin, philosophische Praktikerin und Lehrende an der Universität Wien, der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und der Donau Universität Krems. Ihr neues Buch (gemeinsam mit Monika Mokre) ist gerade bei Nomos erschienen: Postmarxistisches Staatsverständnis (2018).

