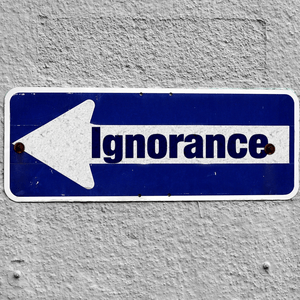
Problematisches Nichtwissen: „White Ignorance“
von Kristina Lepold (Frankfurt)
In ihrer Einleitung zum Themenschwerpunkt notieren die HerausgeberInnen Andrea Klonschinski und Tim Kraft zum Umgang mit Nichtwissen Folgendes: „Manches wollen und sollen wir nicht wissen, manches wollen wir wissen, sollten es aber nicht, anderes wollen wir gar nicht wissen, sollten es aber usw.“ Die Art von Nichtwissen, um die es im vorliegenden Beitrag gehen soll, white ignorance, fällt in die letzte Kategorie. White ignorance stellt eine Art von Nichtwissen dar, das als motiviert (man will hier etwas nicht wissen) und als moralisch problematisch (man sollte hier jedoch ganz unbedingt etwas wissen) beschrieben werden kann.
Geprägt hat den Begriff „white ignorance“ der in den USA forschende und lehrende Philosoph Charles Mills. Mills zufolge umfasst white ignorance als Art von Nichtwissen sowohl falsche Überzeugungen als auch die Abwesenheit wahrer Überzeugungen (Mills 2007: 16) mit Blick auf die Welt, aber auch auf moralische Sachverhalte (ebd.: 22). Ein Beispiel für white ignorance ist etwa die weit verbreitete, aber falsche Überzeugung, dass Schwarze in den USA heute die gleichen Chancen haben wie Weiße. Ebenso kann mangelndes Wissen über die Zeit der Sklaverei oder die sogenannte Jim Crow-Ära nach dem amerikanischen Bürgerkrieg als white ignorance gelten. Aber auch moralische Überzeugungen wie die, dass die europäischen Siedler den amerikanischen Ureinwohnern kein Unrecht zugefügt haben, sind nach Mills’ Verständnis Ausdruck von white ignorance.
Der Begriff „white ignorance“ sagt dabei bereits, dass es bei dem infrage stehenden Nichtwissen um ein spezifisch weißes Nichtwissen gehen soll. Anders gesagt geht es hier um ein Nichtwissen von Weißen, also ein Nichtwissen, das für Weiße als Gruppe irgendwie charakteristisch sein soll (wobei unterschiedliche Mitglieder dieser Gruppe in unterschiedlichem Ausmaß von diesem Nichtwissen betroffen sein können). Es handelt sich also um ein Nichtwissen, das nicht zufällig unter Weißen verbreitet ist. Vielmehr wird ein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zur Gruppe der Weißen und dem spezifischen Nichtwissen behauptet. Doch in welchem Sinn ist hier von Weißen die Rede? Und wie kann die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in diesem Fall zur Gruppe der Weißen, zu Nichtwissen führen?
In diesem Zusammenhang ist zunächst wichtig zu sehen, dass Mills wie viele andere PhilosophInnen (siehe etwa Alcoff 2019 [1997], Root 2000, Haslanger 2012 [2000]) davon ausgeht, dass man nicht einfach „weiß“ ist, weil man zum Beispiel eine helle Hautfarbe hat. Es ist vielmehr der Umstand, dass diese helle Hautfarbe in einer Gesellschaft wie der US-amerikanischen nach wie vor bedeutet, dass man relativ gesehen – zum Beispiel was Lebenserwartung, Bildung oder Sicherheit betrifft – privilegiert ist, die einen „weiß“ macht. Weiße sind damit in erster Linie eine gesellschaftliche Gruppe (siehe zu verschiedenen Verständnissen von race in der aktuellen philosophischen Diskussion auch Lepold & Martinez Mateo 2019: 574–76). Es mag kontraintuitiv klingen, aber nach diesem Verständnis gibt es Weiße oder Schwarze als Gruppen nur, solange es gesellschaftlich einen Unterschied macht, welche Hautfarbe man hat.
Das erklärt jetzt aber noch nicht, wie die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wie die der Weißen über Wissen und Nichtwissen entscheiden können soll. Um diesen Punkt nachvollziehen zu können, muss man etwas weiter ausholen: Eine zentrale Einsicht, die sich bereits in klassischen Texten afro-amerikanischen Denkens (siehe etwa Baldwin 1993 [1961]), aber auch bei vielen feministischen Theoretikerinnen findet (siehe etwa Hartsock 2004 [1983] und Harding 1993) und an die Mills anschließt, ist, dass Gruppen, die gesellschaftlich benachteiligt sind, epistemisch gesehen in einer günstigen Position sind und üblicherweise viel über die sie umgebende soziale Welt und ihre Mechanismen wissen. Der Grund dafür ist, dass benachteiligte Gruppen im Großen und Ganzen ein Interesse daran haben, die Welt um sie herum zu verstehen, zum Beispiel, um für sie selbst gefährliche Situationen zu vermeiden (siehe dazu auch Alcoff 2007: 43–44). Kehrt man diese Einsicht um, folgt daraus zunächst einmal, dass privilegierte Gruppen epistemisch gesehen in einer eher unvorteilhaften Position sind, weil sie über ein solches Interesse nicht verfügen. Er vertritt jedoch noch eine stärkere These. Mills geht davon aus, dass privilegierte Gruppen sogar ein aktives Interesse daran haben, die soziale Welt nicht zu durchschauen oder falsch zu sehen. Weil man davon profitiert, wie die soziale Welt gegenwärtig funktioniert, will man, so Mills, bestimmte Dinge lieber gar nicht wissen (Mills 2007: 34–35; siehe in dem Kontext auch Medina 2013: Kap. 1). Bezogen auf die gesellschaftliche Gruppe der Weißen, die als privilegiert gelten kann, bedeutet das, dass einem das eigene Weißsein ein Motiv an die Hand gibt, nicht zu wissen (siehe hier insbesondere auch schon Mills 1997). Angesichts des Umstands, dass viele Weiße in den USA trotz zur Verfügung stehender Informationen zum Beispiel zur Diskriminierung Schwarzer auf dem Wohnungsmarkt[1] etwa an der Überzeugung festhalten, dass Schwarze heutzutage nicht mehr benachteiligt sind, erscheint die Annahme eines solchen gruppenspezifischen Interesses an Nichtwissen nicht unplausibel.
Mills beschreibt in diesem Zusammenhang ferner eine ganze Reihe epistemischer Prozesse, durch die wir gewöhnlich zu Wissen gelangen, und die im Kontext von white ignorance fehlgehen. So zum Beispiel Wahrnehmung: Wahrnehmung findet wohl nie ohne die Vermittlung durch Begriffe statt und kann daher angemessener oder weniger angemessen sein. Am Beispiel der Kategorie des „Wilden“ erläutert Mills, wie diese Kategorie die Wahrnehmung der Siedler und späterer Generationen des Landes, das sie in Besitz nahmen, prägte; sie hielten dieses Land nämlich nicht nur für unkultiviert, sondern auch für unbesiedelt. Ein weiterer epistemischer Prozess, durch den wir Wissen erlangen, ist der der Bezeugung (testimony): Vieles wissen wir nur dank glaubwürdiger Anderer. Sobald wir aber bestimmten Anderen zum Beispiel aufgrund ihrer Hautfarbe eine geringere Glaubwürdigkeit zuschreiben, wird der Prozess der Bezeugung gestört und können bestimmte Sachverhalte nur noch verzerrt oder gar nicht mehr im öffentlichen Raum zur Kenntnis genommen werden. Was für die einzelne Zeugin oder den einzelnen Zeugen mitunter dramatische persönliche Konsequenzen haben kann (siehe dazu auch Fricker 2007: Kap. 1 und 2), führt auf der sozialen Ebene zu strukturellem Nichtwissen. Man denke zuletzt auch an Praktiken der Erinnerung: In den USA gibt es zum Beispiel eine große Debatte über öffentliche Denkmäler wie die von General Robert E. Lee in Charlottesville, der im amerikanischen Bürgerkrieg die Truppen der Südstaaten und damit auch den Kampf für die Fortführung der Sklaverei anführte. Die kritische Frage, die von vielen gestellt wird, lautet, was es ist, das man aufgrund solcher Denkmäler über die Geschichte der eigenen Gesellschaft lernt beziehungsweise gerade nicht lernt.[2]
Warum ist white ignorance nun eine moralisch problematische Art von Nichtwissen? Die Antwort auf diese Frage sollte bereits deutlich geworden sein. Wenn wir Mills folgen, dann ist white ignorance letztlich deshalb moralisch problematisch, weil sie eine Welt vor kritischer Befragung schützt, in der sich willkürliche Unterschiede zwischen Menschen etwa mit Blick auf ihre Hautfarbe in große Privilegien und Benachteiligungen übersetzen und die somit durch nichts gerechtfertigt sind. Die Hoffnung wäre daher, dass der stückweise Abbau von white ignorance dazu führt, dass dieses Gefüge von Privilegien und Benachteiligungen mehr und mehr infrage gestellt wird und so eine andere, gerechtere soziale Welt möglich wird.
Kristina Lepold ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Sozialphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Sozialphilosophie und politischen Philosophie mit einem besonderen Fokus auf kritischer Theorie.
Literatur
Alcoff, Linda Martín (2007): „Epistemologies of Ignorance: Three Types“, in: Shannon Sullivan und Nancy Tuana (Hg.): Race and Epistemologies of Ignorance, Albany: State University of New York, 39–57.
Alcoff, Linda Martín (2019 [1997]): „Philosophie und Race als Identität“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 67. 4, 589–603.
Baldwin, James (1993 [1961]): Nobody Knows My Name: More Notes of a Native Son, New York: Vintage.
Fricker, Miranda (2007): Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing, Oxford und New York: Oxford University Press.
Harding, Sandra (1993): „Rethinking Standpoint Epistemology: ‚What is Strong Objectivity‘?“, in: Linda Martín Alcoff und Elizabeth Potter (Hg.): Feminist Epistemologies, London: Routledge, 49–82.
Haslanger, Sally (2012 [2000]): „A Social Constructionist Analysis of Race“, in: dies.: Resisting Reality. Social Construction and Social Critique, Oxford: Oxford University Press, 298–310.
Hartsock, Nancy C. M. (2004 [1983]): „The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism“, in: Sandra Harding (Hg.): The Feminist Standpoint Theory Reader. Intellectual and Political Controversies, New York und London: Routledge, 35–53.
Lepold, Kristina und Marina Martinez Mateo (Hg.) (2019): „Schwerpunkt: Critical Philosophy of Race“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 67. 4, 572–588.
Medina, José (2013): The Epistemology of Resistance. Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations, Oxford und New York: Oxford University Press.
Mills, Charles W. (1997): The Racial Contract, Ithaca und London: Cornell University Press.
Mills, Charles W. (2007): „White Ignorance“, in: Shannon Sullivan und Nancy Tuana (Hg.): Race and Epistemologies of Ignorance, Albany: State University of New York, 13–38.
Root, Michael (2000): „How We Divide the World“, in: Philosophy of Science 67 (Supplement: Proceedings of the 1998 Biennial Meetings of the Philosophy of Science Association. Part II: Symposia Papers), 628–639.
[1] Siehe gerade wieder ganz aktuell: https://www.nytimes.com/2019/11/21/opinion/long-island-real-estate-discrimination.html.
[2] Siehe zu der bis heute andauernden Kontroverse etwa: https://www.nytimes.com/2017/08/13/us/charlottesville-rally-protest-statue.html. Wenn man zum Beispiel Praktiken der Erinnerung in der Form von Denkmälern, Schulbüchern, Ausstellungen in Museen etc. betrachtet, wird auch verständlich, weshalb durchaus auch andere gesellschaftliche Gruppen von white ignorance betroffen sein können. Der Zugang zu bestimmten Sachverhalten kann ihnen in diesem Rahmen nämlich ebenfalls verwehrt bleiben.


