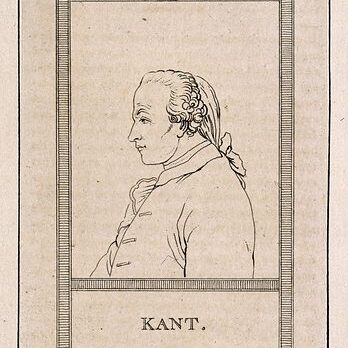
Zum Kant-Jahr: Kant als Politischer Philosoph (1+2)
Immanuel Kant wäre im April dieses Jahres 300 Jahre alt geworden. Praefaktisch begeht das Kant-Jahr 2024 zusätzlich zu unserer 300 Jahre Kant-Reihe mit einem Kurz-Schwerpunkt, der Kant als genuin politischen Philosophen gewidmet sein soll. Der Schwerpunkt erscheint in Kooperation mit dem Theorieblog und besteht aus insgesamt vier Texten. Den Auftakt machen Tamara Jugov, die Kant als Vertreter eines nichtidealen Republikanismus vorstellt (siehe unten) und Andrea Esser, die Kants Fortschrittsbegriff diskutiert (siehe weiter unten). Am 26. September 2024 wird dann Martin Welsch dafür plädieren, Kant als Kritiker der repräsentativen Demokratie zu verstehen und Martin Brecher nach der Aktualität von Kants Plädoyer für Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit vor dem Hintergrund aktueller Debatten fragen. Alle Texte erscheinen zeitgleich auf dem Theorieblog und auf Praefaktisch. Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren!
Kants nichtidealer Republikanismus
von Tamara Jugov (TU Dresden)
Das Interesse an Kants politischer Philosophie ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Galt Kants Rechtslehre (der erste Teil seines 1797 erschienenen Spätwerks Metaphysik der Sitten: RL) im letzten Jahrhundert noch als ein altersschwaches Werk, das in seiner theoretischen Strahlkraft an die drei Kritiken nicht heranreiche, hat sich diese Einschätzung in den letzten Jahrzehnten geändert. So haben Bernd Ludwigs überzeugende Neuedition der Rechtslehre, Arthur Ripsteins großartiges Buch Force and Freedom, das Kants Rechtslehre systematisch rekonstruiert und ins Gespräch mit zeitgenössischen Positionen der anglo-amerikanischen politischen Philosophie bringt, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung sowohl eines „Kantischen Konstruktivismus“ als auch eines „Kantischen Republikanismus“ im deutschen Sprachraum für ein neu entfachtes Interesse an Kants politischen Schriften gesorgt. Insbesondere in den politik- und rechtstheoretischen Überlegungen eines „kritischen“ Republikanismus Frankfurter Provenienz bildet Kants Republikanismus eine wichtige Achse etwa in den Arbeiten von Ingeborg Maus, Peter Niesen, Oliver Eberl und Rainer Forst.
Kants Republikanismus gilt dabei ebenso wie seine Skizze einer globalen Völkerrechtsarchitektur als ein zentraler und auch heute noch aktueller Teil seines Œuvres: Als „höchstes politisches Gut“ identifiziert Kant zu einer Zeit von Kriegen und Konflikten den „ewigen Frieden“. An diesen gelte es sich kontinuierlich anzunähern. Nur ein rechtlich verfasster Friedenszustand vermag es, den ungerechten, da rechtlich nicht geregelten, Naturzustand zu überwinden. Und um den Frieden international zu realisieren, so Kant 1795 in seiner berühmten Schrift Zum Ewigen Frieden (ZeF), bedarf es der internen Organisation von Staaten in Form von „Republiken“. Denn nur republikanisch verfasste Staaten, so Kant, würden die Entscheidung über Krieg und Frieden ihren Bürger:innen überlassen und die freien und gleichen Bürger:innen einer Republik würden sich sehr gut überlegen „ein so schlimmes Spiel anzufangen“ (ZeF AA 8: 351). Diese These eines „demokratischen Friedens“ wurde vielfach diskutiert. Sie erscheint uns heute vor dem Hintergrund der zwischenstaatlichen Aggressionen durch Autokratien, oder von (nicht minder gewalttätigen) internen Konflikten wie aktuell im Sudan, wieder auf schreckliche Weise relevant. Weiter fordert Kant, dass sich Republiken international zu einem „Völkerbund“ zusammenschließen, um Kriege zu unterbinden und zwischenstaatliche Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. Nicht zuletzt greift er mit dem „Weltbürgerrecht“, welches das Verhältnis zwischen Einzelpersonen und fremden Staaten regulieren soll, auf eine solche globalisierte Rechtsform vor, der wir auch heute noch – etwa mit Bezug auf die Regulierung globaler privatrechtlicher Interaktion oder von Migration – dringend bedürfen. Auch mit Blick auf die politische Philosophie lässt sich Kant dabei als Freiheits- und Vernunftphilosoph bezeichnen: Die internationale rechtliche Friedensordnung wird durch die Vernunft identifiziert und ist in der Vernunft sowie der Freiheit des Einzelnen normativ verankert.
Doch während die von Kant skizzierte globale Völkerrechtsarchitektur sich nicht allein in den Feierstunden zu Kants 300. Geburtstag bleibender Relevanz erfreut, ist die damit etablierte Art und Weise über globale Gerechtigkeit nachzudenken auch in den Fokus deutlicher Kritik gerückt. Insbesondere, so eine wichtige Stoßrichtung der Kritik, zeichne sich Kants politische Philosophie durch einen übertriebenen „Utopismus“ aus. Kants Überlegungen zu einer gerechten Weltordnung hätten „Idealtheorien“ Rawlsscher Prägung maßgeblich inspiriert. Eine derartige ideale Theoriebildung sei aber eben nicht die richtige Art der normativen Orientierung für die nichtidealen, realen und drängenden Problemlagen (stellvertretend für viele vgl. Sen). Die Kantische Philosophie verkenne „das Politische“ der politischen Philosophie, so ein weiterer Vorwurf, und letztlich betrieben Ansätze in der Tradition Kants eine Art „angewandte Moralphilosophie“ (stellvertretend für viele, vgl. Williams).
Gegen solche Bedenken möchte ich in diesem Beitrag ein kurzes Plädoyer dafür liefern, dass Kant seinen Republikanismus ganz dezidiert von einer Idee der Ungerechtigkeit her entfaltet, nicht von einem Ideal der Gerechtigkeit. Gegen den verkürzenden Fokus auf die staats- und völkerrechtliche Ausgestaltung von Kants Republikanismus habe ich in meinen Arbeiten versucht, dessen macht- und beherrschungstheoretischen „Unterbau“ stärker herauszuarbeiten. Gelingt diese Argumentation, müssen wir damit beginnen, Kant stärker als einen von nichtidealen Beherrschungsverhältnissen her denkenden Gesellschaftstheoretiker zu lesen (diese Argumentation entwickle ich ausführlich in meinem Buch Geltungsgründe globaler Gerechtigkeit).
Kants Republikanismus wurde bisher primär staats- und völkerrechtlich rezipiert. Dies überrascht nicht, denn Kants Charakterisierung der „reinen Republik“ als einzige Verfassungsform, die Gerechtigkeit und Frieden zu realisieren vermag, zeichnet eine solche staatliche Legitimitätstheorie, die uns in vielen Elementen überzeugend scheint, so etwa in ihrem normativen Individualismus, in der Forderung nach dem Prinzip der Gewaltenteilung, dem Rechtsstaatsprinzip oder in dem offensichtlich vertretenen Ideal einer demokratischen Volksherrschaft. Gleichzeitig bleiben in Kants Staats- und Völkerrecht viele wichtige Fragen offen: Obschon die republikanische Staatsform letztlich die Gleichheit und Freiheit Einzelner realisieren soll, bleibt Kants Konzeption individueller Widerstandsrechte gegen ungerechte Staaten äußerst restriktiv. Obwohl Kant die Französische Revolution glühend bewundert, spricht er sich in der Rechtslehre gegen Revolutionen aus. Obwohl Kant seine Vertragstheorie im einzig „ursprüngliche(n), jedem Menschen, kraft seiner Menschheit, zustehende(n) Recht“ der individuellen „Freiheit als Unabhängigkeit“ verankert, gilt der Bürgerstatus der kantischen Republik explizit nicht für Frauen und Besitzlose. Und obwohl Kant sich an anderer Stelle rassistisch äußert, lehnt er den Kolonialismus in der Rechtslehre explizit ab.
Solche Fragen zu seiner „idealen“ Staats- und Völkerrechtstheorie lassen sich meiner Meinung nach erst dann zufriedenstellend beantworten, wenn wir genauer betrachten, wie Kant die normativen Defizite der Alternative – also eines Zustands ohne Recht und ohne Republiken – versteht. Wie viele Vertragstheoretiker vor ihm entwickelt Kant die von ihm postulierte Pflicht zum Eintritt in staatliche Institutionen als Antwort auf die normativen Defizite des sogenannten Naturzustandes. Der zentrale normative Missstand des kantischen Naturzustands liegt in der dort notwendigerweise auftretenden Existenz von Beherrschungspraktiken. Den Naturzustand versteht Kant dabei als einen privatrechtlich geregelten Zustand; Personen können hier Rechte (etwa auf äußeres Eigentum) in einem „provisorischen“ Modus beanspruchen. Dabei – dafür sorgt die Rechtsform selber – schaffen sie für alle anderen jedoch neue normative Verpflichtungen, etwa sich des beanspruchten Rechtsgegenstands zu enthalten. Unklar ist dabei, so Kant, woher genau Personen im Naturzustand die Autorität haben, andere derartig zu verpflichten. Durch unilaterale Rechtstitelerhebungen schwingen sich Personen im Naturzustand ganz notgedrungen zu kleinen Mini-Souveränen gegenüber allen mit ihnen über Interdependenzverhältnisse verbundenen Personen auf, ohne dazu irgendwie autorisiert zu sein. Dies führt sowohl zu Problemen interpersonaler als auch struktureller Beherrschung. Und erst durch die empirisch vermittelten und letztlich strukturellen Effekte eines solchen provisorischen privatrechtlichen Geflechts entsteht Kant zufolge die Notwendigkeit zum Eintritt in eine republikanische Verfassung. Um Kant tatsächlich als Gewährsmann eines nichtidealen Ansatzes zu etablieren, müssen wir uns also vor Augen führen, dass Kant den strukturellen und empirisch vermittelten Charakter der Machtproblematik in seiner Rechtslehre überraschend stark betont. Entsprechend versteht er die normative Problematik des Naturzustandes primär als eine beherrschungstheoretische.
Für diese Interpretation lassen sich weitere Belege anführen, die ich hier freilich nur kurz anreißen kann. Erstens verletzen die Verhältnisse im Naturzustand Kant zufolge zwar das einzig „angeborene“ natürliche Freiheitsrecht. Die „Freiheit (als Unabhängigkeit von eines Anderen nötigender Willkür)“ spezifiziert Kant weiter als „die Qualität des Menschen sein eigener Herr (…) zu sein“ (RL AA 6: 237f.). Hier verankert Kant seinen Republikanismus in einem solchen Meta-Recht, das die Freiheit von Beherrschung – also einen bestimmten sozial gesicherten und modal robusten Status gegenüber Dritten – fordert. Damit ist der normative Kern der Kantischen Rechtslehre eben kein vorpositives individuelles Recht, das natürliche Ansprüche schützt. Vielmehr ist es ein relationales und soziales Recht, das lediglich in korrektiver Abhängigkeit zu bereits bestehenden Verteilungen inhaltlich ausbuchstabiert werden kann.
Zweitens glaube ich, dass der behandelte Gegenstand von Kants Rechtslehre – nämlich die äußere Freiheit, beziehungsweise die „Freiheit der Willkür“ (RL AA 6: 216 vgl. 6: 226) von Personen – im Sinne einer allgemeinen Konzeption befähigender Macht, d.h. von „power to“ gelesen werden muss. Willkürfreiheit ist nicht als Handlungsfreiheit zu verstehen, etwa als die Freiheit zwischen Optionen oder Handlungen ungestört wählen zu können. Es geht vielmehr um das Vermögen, gewünschte Zwecke in der Welt aktualisieren zu können (hierfür spricht insbesondere, dass Kant Willkürfreiheit als einen Unterfall das „Begehrungsvermögens“ versteht).
Drittens versteht Kant Machtordnungen in der Rechtslehre in einem dezidiert strukturellen Sinne. Diese lassen sich ihm zufolge erst durch einen Fokus auf die empirisch vermittelten Effekte der freien Willkürausübung einer über Interdependenzbedingungen miteinander verbundenen „Multitude“ (RL AA 6: 313) von Personen theoretisch fassen. Nach Kant führt eine Menge unilateraler Rechtstitelerhebungen von Personen im Naturzustand notwendig zu strukturellen Überschüssen auf die Willkür Dritter. Diese Überschüsse nehmen in ihrer kollektiven Verschränkung objektive Qualität an und stellen damit nicht nur, wie Rainer Brandt sagt, „empirisch-apriorische Gegebenheiten“ (2015: 689) dar, sondern bilden auch das Problem, das Kant zu seiner politisch-institutionellen Perspektive auf moralische Fragen erst motiviert.
Erst wenn wir den kollektiven und strukturellen Charakter von Kants machttheoretischer Charakterisierung von „Ungerechtigkeit“ im Naturzustand in den Blick nehmen, können wir nachvollziehen (wenn auch nicht notwendigerweise rechtfertigen), warum Kant dem Schritt der Zusammenfassung einer „Multitude“ zu einer rechtlich verfassten Gemeinschaft für normativ so bedeutsam hält, dass er individuellen Personen kein Widerstandsrecht und Kollektiven kein Revolutionsrecht gegen den Staat zugesteht. Mit Blick auf die gesellschaftstheoretischen Wurzeln seines Arguments, die von dezidiert nichtidealen Verhältnissen ausgehen, gibt es also auch in Kants politischer Philosophie noch Neues zu entdecken.
Tamara Jugov ist Professorin für Praktische Philosophie an der TU Dresden. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der politischen Philosophie, der Sozialphilosophie und der feministischen Philosophie. In ihrem Buch „Geltungsgründe globaler Gerechtigkeit“ entwickelt sie einen von Kants nichtidealem Republikanismus ausgehenden beherrschungsbasierten Ansatz zur Theoretisierung globaler Ungerechtigkeit.
Es geht voran?
Kants Begriff des Fortschritts in der Kritik
von Andrea Esser (Friedrich-Schiller-Universität Jena)
Es mag vielleicht irritierend wirken, sich von einer Beschäftigung mit Kants Begriff des Fortschritts heute noch aufklärende Einsichten zu versprechen. In Anbetracht der kaum aufzuhaltenden Naturzerstörung, der gegenwärtigen Kriege, der Zunahme autoritärer Staaten und Strukturen scheint „es“ insgesamt alles andere als „voran“ zu gehen. Skepsis gegenüber dem Fortschrittsbegriff ist darüber hinaus auch angebracht, weil unter Berufung auf „Fortschritt“ so viel koloniales Unrecht, so viel Gewalt und Unterdrückung geschehen und gerechtfertigt wurde. Gerade im Rahmen der aktuellen, häufig überwiegend affirmativ gehaltenen Kant-Feierlichkeiten sollten wir uns meines Erachtens bei der Beschäftigung mit Kants Fortschrittskonzeption fragen: Können wir heute tatsächlich an das ganze Fortschrittskonzept Kants ohne weiteres anschließen? Und wenn nicht: Welche der Einsichten sind es, die wir für eine angemessenen Weiterentwicklung dieses Konzeptes in unserer Gegenwart nicht verlieren sollten?
Kant hat – gemessen am Diskurs der Schulphilosophie seiner Zeit – eine kritische Neubestimmung des Fortschrittsbegriffs unternommen. Seine Leistung liegt darin, vor allem das emanzipatorische Potential des Begriffs deutlich heraustreten zu lassen. Im 17. und 18. Jahrhundert fragten eine ganze Reihe von Autoren nach der Möglichkeit eines Fortschreitens der Menschen und der Menschheit zum Besseren (vgl. Koselleck: Fortschritt, in: Geschichtliche Grundbegriffe). Begriffe wie die Vervollkommnung und die Zweckmäßigkeit der Welt bzw. der Natur, in der Vervollkommnung und Fortschreiten ja verwirklicht werden sollen, gewinnen dabei an Bedeutung. Kant nimmt Bezug auf diese Diskussionen. Die Originalität seines Beitrags und die Besonderheit seines Fortschrittsverständnisses wird besonders klar in der Absetzung etwa von Christian Wolffs Ausführungen in seiner „Philosophia rationalis sive logica“ (1728). Wolff richtet den Imperativ der Vervollkommnung an Individuen. Die Frage nach der Möglichkeit der Verwirklichung dieses Imperativs in dieser Welt wird von ihm mit der Zweckmäßigkeit der Natur und der Güte Gottes beantwortet. Außerdem versteht Wolff seine Untersuchung über die Zweckmäßigkeit der Welt, die er als „Teleologie“ bezeichnet, explizit als eine „Wissenschaft“. Der Begriff der Zweckmäßigkeit ist dabei ein objektiver Begriff, auf dessen Grundlage man entsprechend auch in einer Theorie zu objektiven Erkenntnissen gelangen kann. Mit diesen teleologischen Grundannahmen bricht Kant – spätestens, wenn er in der Kritik der Urteilskraft das Prinzip der Zweckmäßigkeit kritisch begründet und damit auch den Status aller Urteile, die auf dieser Grundlage gefällt werden, fundamental verändert.
- Die erste Veränderung ist der Schritt zu einem geschichtsphilosophischen Verständnis des Fortschrittsbegriffs. Kant richtet die Fortschrittsforderung nicht, wie Wolff, an das Individuum, sondern bezieht sie auf die Geschichte der Menschengattung. Die fortschreitende Verwirklichung der Moralität und die damit verbundene Humanisierung – das sind die normativen Orientierungen dieses Prozesses (und nicht etwa der technische oder ökonomische Fortschritt) – sollen als ein kooperatives Unternehmen über Generationen hinweg verstanden werden. Damit löst Kant ein Problem, das in der Debatte um Wolffs Imperativ auftrat: dass es nämlich dem einzelnen Menschen auf Grund seiner kontingenten Lebensumstände und seiner begrenzten Lebenszeit oft gar nicht möglich ist, sich zu vervollkommnen.
- Die zweite Veränderung liegt in der Präzisierung des Ziels des Fortschritts. Vollkommenheit wird von Kant als die vollständige Entfaltung der Vernunft bestimmt. Die aber ist nur innerhalb einer von den Menschen selbst gestalteten freiheitlichen Vereinigung aller Menschen möglich in einem – von Kant so genannten – „Weltbürgertum“, das dauerhaften Friedenszustand garantiert. Diesen Zustand zu erreichen, setzt die „Kultivierung“ und „Zivilisierung“ der Menschen voraus, aber vor allem, dass sich immer mehr Staaten bürgerlich-republikanische Verfassungen geben und sich untereinander vereinigen. Die Präzisierung des Zieles eröffnet immerhin die Möglichkeit, erreichte Fortschritte als solche zu identifizieren. Denn dieser Bestimmung entsprechend zeigt sich der Fortschritt in errungenen Gleichheits- und Freiheitsrechten, und nicht etwa in schwer zu bestimmenden Gesinnungen und Einstellungen.
- Die dritte, und systematisch wichtigste Veränderung richtet sich auf die Frage, ob wir das in dieser Welt auch verwirklichen können, was wir sollen. Diese Frage zielt auf die Verfasstheit der Natur. Sie erscheint oft mindestens als gleichgültig, wenn nicht sogar hinderlich gegenüber der Verwirklichung unserer vernünftigen und moralischen Ziele. Die Kantische Lösung ist gewagt und man könnte zunächst meinen, dass sie ganz in Kontinuität mit der teleologischen Tradition steht. So liest man etwa in der späten Friedensschrift (1795) gleich zu Beginn, dass „die große Künstlerin Natur“, die Gewähr und Garantie (im Sinne eines „mächtigen Beistands“) dafür sei, dass die Menschheit sich dem angestrebten Zustand des „Weltbürgertums“ auch tatsächlich annähert. An anderen Stellen ist sogar die Rede davon, dass sich ein „Plan der Natur“ erkennen ließe und die Natur so gesehen für die Verwirklichung unserer vernünftigen und moralischen Ziele als zweckmäßig eingerichtet beurteilt werden könne. Die Rede von einem Plan einer „handelnden Natur“ unterscheidet sich allerdings fundamental von dem Verständnis der traditionellen Teleologie. Durch Kants kritische Begründung des Begriffs der Zweckmäßigkeit hat auch der Begriff der Natur verschiedene Bedeutungen mit je unterschiedlichem Status erhalten. Die Kritik der Urteilskraft unterzieht alle Urteile, die auf der Grundlage des Prinzips der Zweckmäßigkeit gefällt werden, einer Neubestimmung ihres Geltungsanspruchs: sie sind nunmehr bloß reflektierende Urteile. Sowohl das teleologische Urteil über die Natur als auch das geschichtsphilosophische Urteil über einen Fortschritt der Menschengattung in der Natur gründen sich auf das Prinzip der Zweckmäßigkeit. Letzteres vermittelt Vorstellungen davon, wie natürliche Gegebenheiten und Ereignisse in der Natur den menschlichen Fortschritt fördern und unterstützen können. Entscheidend ist dabei: Als reflektierendes Urteil verliert das geschichtsphilosophische Urteil den objektiven Anspruch eines Erkenntnisurteils (den es noch bei Wolff hatte). Das bedeutet: geschichtsphilosophische Urteile können in der Folge nicht als objektive Beschreibungen weder von Gegenständen noch von gesellschaftlichen oder historischen Ereignissen gelten. Ihre Aussagen sind immer nur im Rahmen einer Reflexion gültig und ermöglichen entsprechend auch keine abschließende Prädikation. Eine erschütternde Katastrophe, ein verheerender Krieg, eine blutige Revolution können in der geschichtsphilosophischen Reflexion als Anlässe beurteilt werden, die auch etwas Positives und einen Fortschritt zum Besseren ausgelöst haben; das mag der Fall sein, wenn z. B. endlich Verhandlungen geführt oder emanzipatorische Rechte etabliert oder verbessert werden. Doch die geschichtsphilosophische Reflexion darf sich dennoch nicht dazu versteigen, den Krieg und die Katastrophe selbst als etwas Gutes zu bestimmen. Sie muss ihr Urteil für weitere Reflexionen, die auf Grund sich verändernder Umstände zu einem anderen Urteil gelangen, offenhalten. Kant vollzieht mit dieser kritischen Neubestimmung des teleologischen Urteils eine grundsätzliche Kritik an der gesamten, zu seiner Zeit noch prominenten Tradition.
Doch bei aller Anerkennung für diese kritische Begründung des geschichtsphilosophischen Urteils: sie sollte meines Erachtens nur der Anfang und nicht das Ende einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff sein. Denn wir müssen bei Begriffen, auf die uns die praktische Vernunft leitet, auch die gesellschaftlichen und globalen Folgen, die ein Begriff in der sozialen Kommunikation und Praxis zeitigt, berücksichtigen. Die praktischen Folgen zeigen möglicherweise problematische Dimensionen bereits gewonnener Bestimmungen des Begriffs. Sie zur Kenntnis zu nehmen, ist unerlässlich, um den betreffenden Begriff in einer sich verändernden Lebenswelt weiterzuentwickeln. Zu fragen ist daher: Welche Bestimmungen des Fortschrittsbegriffs bergen Anknüpfungspunkte für – bis heute wirksame – Pseudorechtfertigungen von ungerechter Ungleichheit, Überheblichkeit oder ideologische Legitimationen von Macht- und Ausbeutungsinteressen?
Ich versuche, dazu eine, wenn auch sicher nicht erschöpfende Überlegung zu formulieren.
Kant hat meines Erachtens an vielen Stellen seine eigene kritische Begrenzung des geschichtsphilosophischen Urteils unterschritten. Und es sind diese Stellen, die einem problematischen Verständnis des Fortschritts Vorschub leisten, weil in ihnen die ideologische Unterscheidung von „fortgeschrittenen“ und „zurückgebliebenen“ bzw. in ihrer Entwicklung „stagnierenden“ Völkern tradiert und im Diskurs gehalten wird. Um die betreffenden Stellen kritisch zu rezipieren, ist es wichtig zu wissen, dass Kant – wie viele seiner Zeitgenossen – mit dem Fortschrittsbegriff unter Rekurs auf die oben erwähnten Prozesse der Kultivierung und Zivilisierung auch bestimmte Menschengruppen und Ethnien in konkrete Stadien der Entwicklung in der Zeit sortiert und hierarchisiert hat. Die Verbindung des Fortschrittsbegriffs mit konkreten Phänomenen ist zwar ohne Frage wichtig. Aber es ist gerade dieser Bezug auf die Lebenswelt, der es nötig macht, die Kritik auch nach der Grundlegung des Fortschrittsbegriffs noch weiter fortzusetzen.
Nicht nur in Vorlesungsnachschriften, sondern auch in den veröffentlichten Schriften, in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht oder in der Kritik der Urteilskraft, werden Menschengruppen und Ethnien – insbesondere: sie abwertende – Eigenschaften zugeschrieben. Diese Zuschreibungen stammen in großen Teilen aus zeitgenössischen Reiseberichten und sind in den Debatten der Zeit fest etabliert: so etwa der Topos der Indolenz. Er wird in vielen Quellen aufgerufen und bezeichnet die vorgeblich „natürliche Faulheit und Trägheit“ indigener Bewohner insbesondere heißer Klimazonen, die bereits mit der Betitelung als „Wilde“ in ein frühes Stadium der Menschheit verwiesen werden. Der Topos selbst ist also keine Erfindung Kants, sondern wird von ihm aufgenommen. So ist etwa in Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht die Rede von „dem“ (in der zeitgenössischen Diskussion regelmäßig angeführten) „Caraiben“. Ihn kennzeichnet vorgeblich eine „angeborene Leblosigkeit“, wie es auch in zahlreichen Reiseberichten heißt. Damit wird ihm sowohl der unmittelbare Antrieb abgesprochen, sich weiterzuentwickeln und zu vervollkommnen, als auch die Sensibilität für die „Stacheln der Tätigkeit“, mit denen die Natur ihn zur Erfüllung ihres Plans anzutreiben versucht. Die „Stacheln“ werden im Rahmen der geschichtsphilosophischen Reflexion als Anlässe beurteilt, um „aus dem gegenwärtigen Zustande herauszugehen“ und in Kultivierung und Zivilisierung fortzuschreiten. Die Darstellungen in den Reiseberichten, die für Kant die Quellen bilden, sind selbst aber keine objektiven Beschreibungen, auch wenn sie sprachlich so formuliert sind. Sie sind vielmehr Ergebnisse unkritisch-teleologischer Vorurteile, die sich dogmatisch auf europäischen Vorstellungen von Kultivierung und Zivilisierung gründen. Und es sind diese unkritisch-teleologischen Beurteilungen, die ungeprüft als vorgeblich empirische Beobachtungen und Beschreibungen in Kants geschichtsphilosophische Reflexion eingewandert sind. In der Folge werden sie dann – freilich unzulässig – von ihm zum Beleg einer Fortschrittsfähigkeit oder eben -unfähigkeit bestimmter Gemeinschaften herangezogen. In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten trifft man, ganz losgelöst von einer geschichtsphilosophischen Reflexion, auf die sogenannten „Südsee=Bewohner“, die als weithin bekanntes Beispiel für die Indolenz indigener Ethnien angeführt werden. Sie bilden im Zusammenhang der moralphilosophischen Grundlegung eine Veranschaulichung für die Verletzung der Pflicht gegen sich selbst, seine Talente auszubilden. Kant hat es versäumt, hier die Kritik, die er an der unkritischen Teleologie selbst formuliert hat, auch auf seine Quellen anzuwenden, deren er sich bedient, um dem Fortschrittsbegriff einen Inhalt oder um Beispiele für eine vorgeblich moralische Rückständigkeit zu geben.
Einmal mehr werden die kritischen Grenzen unterschritten, wenn die Maßstäbe, die innerhalb der kritisch-teleologischen Reflexion zur Anwendung kommen, selbst nicht kritisch reflektiert werden. Das ist dann der Fall, wenn die Schritte in Richtung auf das globale Ziel der weltbürgerlichen Gemeinschaft ausschließlich unter Bezug auf lokale (in diesem Fall europäische) Vorstellungen von Kultivierung und Zivilisierung beurteilt werden. Wenn es darum gehen soll, Einsichten, Errungenschaften oder soziale Praxen auszumachen, die dem globalen Ziel der weltbürgerlichen Gemeinschaft zuträglich sein könnten, müssen sie aber auch unter globalen (und das bedeutet: pluralen) und nicht nur unter lokalen Perspektiven gemeinschaftlich gewonnen und geprüft werden. Statt die Zielbestimmung des Fortschritts – die Idee eines rechtlich gegründeten, weltbürgerlichen Friedenszustandes zur Erweiterung und zur Dezentrierung der eigenen Wertüberzeugungen zu nutzen, werden die lokalen Errungenschaften als „global“ gesetzt und Anpassung gefordert. Auf diese Weise verwandelt sich die emanzipatorische Dimension der Idee des Weltbürgertums in Repression – und das kann nicht nur zu Kants Zeiten, sondern auch heute noch eintreten.
Andrea Marlen Esser ist seit 2015 Professorin für Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Vorher Professuren an der Philipps-Universität Marburg, der RWTH Aachen und der Hochschule für Gestaltung Pforzheim. Seit 2022 Leiterin des Koselleck-Projekt der DFG „Wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Klassischen Werken der Deutschen Philosophie?“. Sie ist außerdem Herausgeberin von Kants „Critik der Urtheilskraft“. im Rahmen der Neuedition von Kants Akademie-Ausgabe der BBAW.
Veröffentlichungen:
„Angehende Menschen“, in: Zeit-Magazin Geschichte, (2024/1) S. 40-51.
Meisterstück? Kritik und Grenzen der Kritik: Zweckmäßigkeit der Natur in Kants Kritik der Urteilskraft. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik, ZDPE 2024/1. 94-104.
„Freiheit in der Erscheinung”. Überlegungen zu Schillers Kant-Rezeption in den ästhetischen Vorlesungen’: In Freiheit im Werden? Schillers Vorlesungen an der Universität Jena, ed. by Helmut Hühn, Nikolas Immer and Ariane Ludwig. Hannover, Wehrhahn, 2022 (bool series: Schiller-Studien 2), 59–107.



