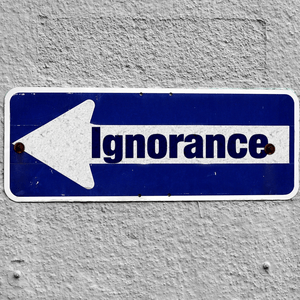
„Know nothing“ als Resultat des Philosophie- und Ethikunterrichts?
von Clemens Sander (Wien)
Ein philosophiebegeisterter Schüler, der in der Oberstufe an meinem sokratisch geprägten Ethik- und Philosophieunterricht teilgenommen hatte, schenkte mir zum Abschied ein T-Shirt auf dem Sokrates’ Gesicht zu sehen ist, und darüber steht in großen Lettern: KNOW NOTHING. Natürlich freute ich mich über das herzliche Geschenk, aber es brachte mich auch zum Nachdenken: Versteht der Schüler das als Aufforderung, ist das seine Quintessenz aus der Beschäftigung mit Philosophie?
In der Präambel des von der Bundes-ARGE Ethik (Bundesarbeitsgemeinschaft der EthiklehrerInnen Österreichs) vorgeschlagenen Lehrplans für den Ethikunterricht in Österreich steht, dieser sei weder wertrelativistisch noch dogmatisch. Das trifft sich eigentlich gut, ich verstehe mich weder als Relativist noch als Dogmatiker. Trotzdem muss ich zugeben, dass der Ethikunterricht bei einigen Schüler_innen, gerade bei den besten und interessiertesten, auch einen gewissen Skeptizismus und Relativismus zur Folge hat. Nicht, dass ich diesen bewusst predigen würde, im Gegenteil, in meiner Einführung in das Fach zeichne ich nach, wie die Ethik von Sokrates, Platon und Aristoteles als Gegenreaktion auf den Subjektivismus der Sophisten, insbesondere Protagoras, begründet wurde. (Dazu lesen wir Originalstellen aus dem platonischen Dialog Gorgias, es freut mich immer wieder wie gut das mit 15-Jährigen funktioniert, der sokratische Humor scheint zeitlos zu sein.)
Und doch kann es ein Effekt des Ethikunterrichts sein, dass nach der vierjährigen Tour durch die verschiedenen Philosophien, Ethiken und Religionen Schüler_innen zu dem Schluss kommen, dass alle Positionen gleichberechtigt und gleichwertig nebeneinander stehen, weil es zum Unterricht dazugehört, nie die kritischen Stimmen und Gegenargumente unter den Tisch fallen zu lassen. Ich kann mich gut erinnern, wie eine Gruppe an Schülern zuerst dürstend nach einem Fundament begeistert Kants Moralbegründung übernahm, aber dann ernüchtert zugeben musste, dass auch die Kritik daran zum Teil Hand und Fuß hat. (Auch wenn ich mich persönlich gefreut hätte, der immer utilitaristischer denkenden Jugend als Ausgleich eine größere Portion Gesinnungsethik mit auf den Weg zu geben, kann ich dies nicht in manipulatorischer Form machen.)
Wie verhält es sich aber mit dem Boden, auf dem der Ethikunterricht steht: Demokratie, Aufklärung, Würde des Menschen als Person? Auch wenn es das Ziel ist, diese Werte zu stärken (was, soweit ich es sagen kann, im Ethikunterricht grundsätzlich erreicht wird), heißt das nicht, dass man sich nicht auch ernsthaft mit Platons Zweifel an der Demokratie (wie auch im Höhlengleichnis ausgedrückt), Horkheimers und Adornos Abrechnung mit den Folgen der Aufklärung oder Benthams, Nietzsches und Foucaults bissiger Kritik am Konzept der Menschenrechte auseinandersetzt. Wenn man Lao Tse unterrichtet ist das für einen der Aufklärung verpflichteten Ethiklehrer die höchste Form der Selbstkritik, denn ihm zufolge ist Nachdenken über das Gute kontraproduktiv.
Dass ich mit meinen Gedanken über diesen möglichen Effekt meines Faches nicht alleine bin, merkte ich bei einem Vortag von Anne Burkard („Beiträge und Grenzen philosophischer Bildung im Umgang mit Fake News“ Universität Wien, 22.5.2019[i]). Dabei sprach sie die Gefahr an, dass ein philosophischer Unterricht auch kontraproduktiv für die Differenzierungsfähigkeit sein und zu einer „Whatever-Einstellung“ beitragen könne. Der liberale Zugang, dass jeder ein Recht auf eine Meinung hat, werde mitunter mit Beliebigkeit verwechselt, dass alle Meinungen gleich viel wert seien. Ja, das kann passieren: Das Resümee so mancher Schüler_innen über das verpflichtende Jahr Philosophieunterricht, das es an Österreichs Gymnasien gibt, ist, dass es spannend war und zum Denken angeregt hat, aber da sich die großen Geister gegenseitig und nicht selten sich selbst widersprechen, wie sollen sie da selbst je auf eindeutige Antworten auf philosophische Fragen kommen? Wenn man keine Philosophie als letztgültige Wahrheit präsentiert bekommt, dann müsse die Frage nach der Wahrheit in diesen Dingen unbeantwortbar sein und Philosophie sei daher nicht mehr als ein Nichtwissen, das um sich selbst weiß.
Kurz davor hatte mich eine konservative Politikerin zu einem Vortrag des mir bis dahin unbekannten deutschen Philosophen und Journalisten Alexander Grau eingeladen, und dieser schlug in die gleiche Kerbe. Er ging so weit, Ethik als die „Geburtsstunde des Nihilismus“ zu bezeichnen. Allein der Versuch, Moral rational zu begründen, relativiere diese. Ethik säe Zweifel, wo Gewissheit war und unterminiere damit die Unbedingtheit traditioneller moralischer Gebote. (Nietzsche bemerkte einmal, man könne jemanden, der sagt, er brauche Gründe, um anständig zu sein, nicht länger trauen, denn es könnte ja sein, dass dieser seine Auffassung ändert. Aus ähnlichen Gründen nannte Luther die Vernunft eine Hure).
Wenn es also tatsächlich im Wesen des Faches selbst liegen könnte, wie kann und soll ich dann vermeiden als sein Vertreter zu einem Geburtshelfer des Skeptizismus zu werden? Ich suchte nach einer Antwort bei Hannah Arendt, die berühmt für ihre sokratische Gesinnung und ihren sokratischen Unterricht war. Manche Sätze in dem Büchlein „Sokrates. Apologie der Pluralität“ wirken ebenso ernüchternd: „Nach all dem, was wir von Sokrates´ Wirkung wissen, ist es offensichtlich, dass viele seiner Zuhörer nicht mit einer wahrhaftigeren Meinung nach Hause gegangen sind, sondern mit gar keiner. […] Alle Meinungen sind zerstört, aber keine Wahrheit tritt an ihre Stelle.“[ii]
Ironie über Ironie, wofür Sokrates damals vom Staat zu Tode verurteilt wurde, dafür werde ich heute vom Staat bezahlt? Weiß der Staat, was er da macht? Ganz so ist es natürlich nicht. Auch die relativistischen Schüler_innen kommen nicht ohne Überzeugungen aus dem Ethikunterricht, aber nach ihrem Streifzug durch verschiedenste Kulturen und mehrere mehr oder weniger rationale Moralbegründungen wissen sie, dass, wenn sie anders aufgewachsen wären oder sich für eine andere Denkart entscheiden würden, sie zum Teil eine andere Moral hätten und auch diese nicht völlig unbegründbar wäre. Das ist ganz im Sinne von Hans Kelsen, der als „Vater“ der österreichischen Verfassung gilt. Für ihn liegen die Bedingung, das Wesen und der Wert der Demokratie darin, dass man die fremde, gegenteilige Meinung zumindest für möglich hält. Werten und Normen eine unhinterfragbare, absolute Gültigkeit zuzusprechen ist bei Kelsen ein Dogmatismus, auf einer Ebene mit dem religiösen Fundamentalismus. Daher findet sich in der Präambel des Ethiklehrplans die Betonung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Ist aber diese undogmatische Form des Gesprächs, die Hannah Arendt Sokrates zuschreibt, immer und überall möglich und wünschenswert? Müssen alle Fragen in einer Aporie, einer niveauvollen Ratlosigkeit enden? Für den englischen Literaturtheoretiker Terry Eagleton ist der Glaube, dass man die Dinge nur dann richtig sehe, wenn man nicht Partei ergreife, ein Mythos: „The liberal has difficulty with situations in which one side has a good deal more of the truth than the other.”[iii]
Auch Anne Burkard warnte in ihrem Vortrag vor der „Verzerrung der Ausgewogenheit“ bei manchen Themen, und für die Ethikerin Annemarie Pieper gehört zur Ethik auch eine Portion „kritische Intoleranz“. Wenn z. B. – das ist jetzt kein fiktives Beispiel – ein Schüler Stalin einen guten Mann sein lassen will, kann ich mich als Lehrer nicht auf mein philosophisches Nichtwissen berufen, nicht mit Kelsen sagen, es gebe keine moralischen Wahrheiten, nicht mich auf Wittgenstein berufen und schweigen, weil sich die Ethik nicht aussprechen lasse. Sokrates hat seine ethischen Diskussionen auch nicht immer in Aporien enden lassen. Wenn er z.B. im Dialog Gorgias gegen Kallikles antritt, der für das Recht des Stärkeren und dessen bedingungsloses Recht auf Lust argumentiert, ist es ihm sichtlich nicht egal, wie die Diskussion ausgeht. Er weiß, dass Kallikles falsch liegt, und sagt ihm das auch: Glücklich werde man „nicht aber so, dass man die Begierden zügellos werden lasse, und im Bestreben, sie zu befriedigen, ein überschwengliches Übel, das Leben eines Räubers lebe. Denn weder mit einem andern Menschen kann ein solcher befreundet sein, noch mit Gott; denn er kann in keiner Gemeinschaft stehen, wo aber keine Gemeinschaft ist, da kann auch keine Freundschaft sein.“ (Gorgias 507e)
Sokrates vertrat im Gegensatz zu den Sophisten und Skeptikern eben keine „Philosophie der Gleichgültigkeit“ (Isosthenie), wonach es zu jedem Argument ein Gegenargument gleicher Stärke gebe. Die Absenz jeglicher Urteilskraft ist nicht sokratisch. Genau darüber schäumt Nietzsche unter der Überschrift „Das Problem des Sokrates“. Er hält dem Athener entgegen: „Urteile, Werturteile über das Leben, für oder wider, können zuletzt niemals wahr sein: sie haben nur Wert als Symptome, sie kommen nur als Symptome in Betracht – an sich sind solche Urteile Dummheiten.“ (Götzen-Dämmerung KSA 6.68)
Es stimmt schon: Eine Ethik, die sich zu sicher ist, das Gute erkannt und gepachtet zu haben, wird zur Ideologie. Man muss aber nicht so weit gehen wie Alexander Grau, der meint, es gäbe gar keine Moralbegründung ohne Ideologie. Einen Mittelweg im aristotelischen Sinne der Vermeidung von Extremen formuliert die Ethikerin Herlinde Pauer-Studer so: „Die Ablehnung von Fundamentalismus in Wahrheits- und Wertfragen verpflichtet uns nicht auf den Subjektivismus und Relativismus. […] Normen und moralische Prinzipien können als gut begründet gelten, wenn deren Zurückweisung zu Inkohärenzen und Widersprüchen führt und recht besehen keinen Sinn ergibt.“[iv]
Wie Kierkegaard in seiner Dissertation schreibt, ist es Sokrates mit seinem Nichtwissen zugleich ernst und auch nicht. Im Moralischen gibt es für ihn einen Maßstab: Mit sich selbst zusammenstimmen. Auch wenn man beim Menschen als Maß bleibt, wird nicht zwangsläufig alles relativ, wie Protagoras sagte: „Wie alles mir erscheint, so ist es für mich, wie dir, so ist es für dich.“ Die Menschen sind zwar, wie wir aus Erfahrung wissen, verschieden, wandelbar und zu allem fähig. Aber in seiner Wurzel kann der Mensch für Sokrates und Arendt nicht relativistisch sein. Der moralische Relativismus im Sinne davon, für sich selbst eine Ausnahme zu machen – wenn ich das mache ist es ok, wenn du mir das antust werde ich bös – ist nur als Oberflächenphänomen zu haben. Das sokratische Pochen darauf, möglichst nicht mit sich selbst in Widerspruch zu geraten, ist das Gegenteil eines allumfassenden Relativismus. Die nötige Tiefe im Denken und Abstraktionskompetenz versuchen der Philosophie- und der Ethikunterricht zu trainieren. Wenn darin von Vornherein alles Wissen als gleich gültig und damit zum Nichtwissen erklärt würde, wäre er nicht nur langweilig, sondern auch bedenklich.
Clemens Sander unterrichtet Ethik, PUP (Philosophie und Psychologie) und Spanisch am BRG/BORG St. Pölten und ist im Bereich der LehrerInnenbildung der Universität Wien tätig.
[i] Siehe dazu auch: Burkard, A. (2017): “Everyone Just Has Their Own Opinion: Assessing Strategies for Reacting to Students’ Scepticism about Philosophy.” In: Teaching Philosophy 40 (3), S. 297–322.
[ii] Arendt, H. (2016): Sokrates. Apologie der Pluralität. Berlin: Matthes & Seitz, S. 64.
[iii] Eagleton, T. (2003): After Theory. New York: Basic Books, S. 136.
[iv] Pauer-Studer, H. (2018): “Verpflichtet die Demokratie zum ethischen Relativismus?”, in: Der Standard – Philosophieblog, 27.9.2018, https://www.derstandard.at/story/2000088110313/verpflichtet-die-demokratie-zum-ethischen-relativismus




