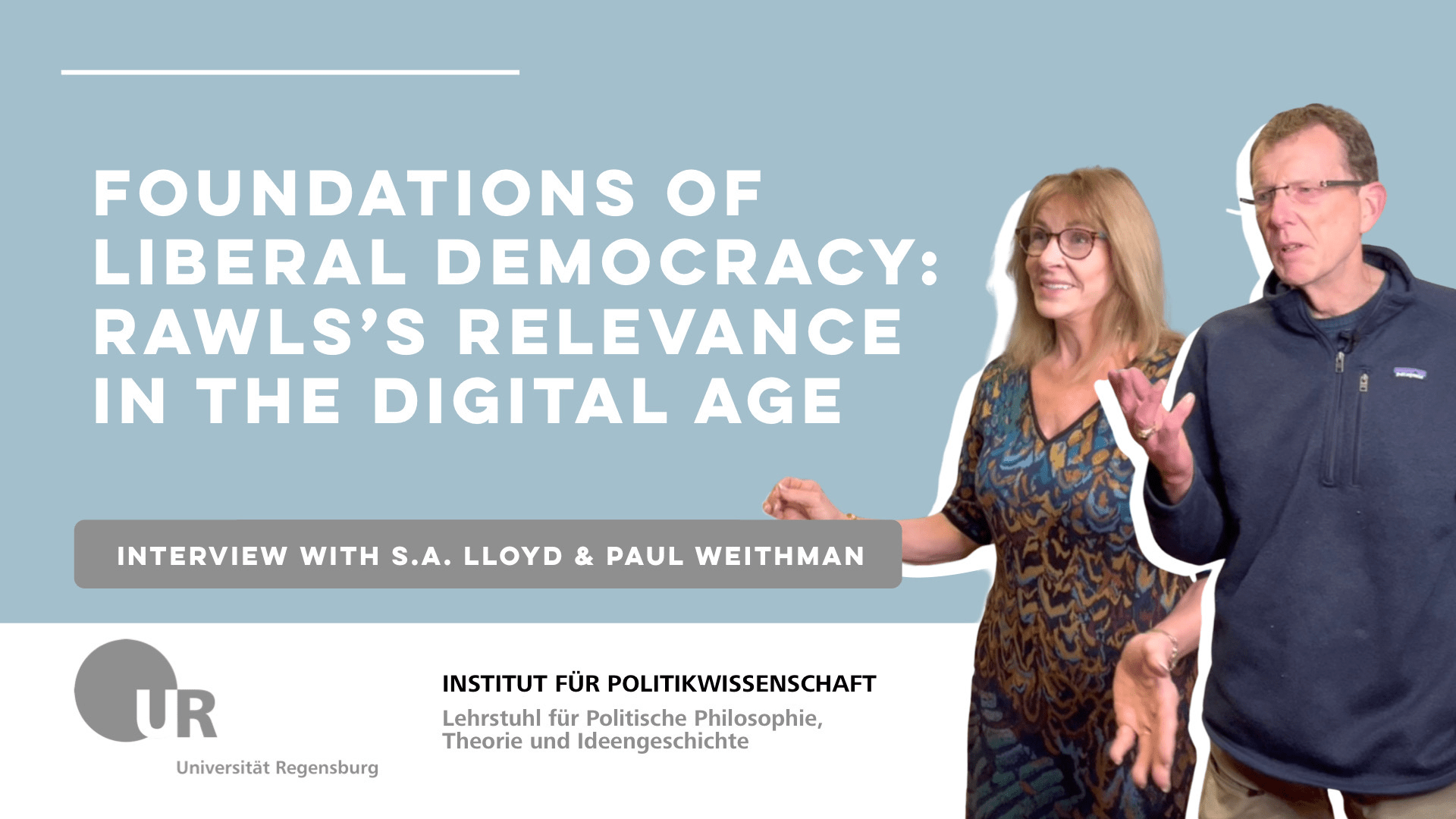
Duties of Civility? – ein Tagungsbericht
von Daniel Beck (TU Dortmund)

Das vielbeschworene Bild kriselnder, sich radikalisierender und polarisierender liberaler Gesellschaften wird wohl angesichts aktueller Umfrageergebnisse rechtspopulistischer Parteien auf absehbare Zeit ein vertrautes bleiben. Auf der Suche nach Maßnahmen zur Stärkung liberaler Demokratie ist guter Rat teuer. Warum also nicht mal bei John Rawls nachfragen?
Es muss doch im besten Fall hilfreich und im schlechtesten Fall interessant sein, das Werk eines der einflussreichsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts zu konsultieren. Diese Idee lag der von Eva Helene Odzuck, Sarah Rebecca Strömel und Daniel Eggers organisierten Konferenz „Duties of Civility? Rawls’s Theory of Deliberative Democracy and its Relevance in the Digital Age” zu Grunde, welche vom 11.03. – 12.03. in Regensburg unter Mitwirkung europäischer und US-amerikanischer Forscher*innen stattfand. Der erfreulich praktische Ansatz der Konferenz zog sich (überwiegend) als roter Faden durch die recht breite Auswahl an Themen, die mal abstrakter und mal direkter Bezug auf nicht-ideale Zustände jenseits der wohlgeordneten Gesellschaft nahmen.
Wahrheit und Rhetorik als Mittel gegen den Populismus
Die Pflicht zur Bürgerlichkeit (duty of civility) ist eine zentrale Säule von Rawls politischem Liberalismus. Sie ruft die Bürger*innen dazu auf, ihre in öffentlichen Foren vorgetragenen Meinungen zu grundlegenden Fragen der Gerechtigkeit derart zu begründen, dass sie aus der Perspektive aller vernünftigen Bürger*innen nachvollziehbar sind. So formulierte Argumente gehen über die Grenzen der Gruppe der sprechenden Person hinaus. Sie bedienen sich an dem von der gesamten vernünftigen Bevölkerung geteilten Fundus an Erklärungen für legitime Herrschaft. Das begründet ihre starke Rolle in der Stabilität pluralistischer, liberaler Demokratien. Wie gehen wir aber mit Personen um, die keine solchen vernünftigen Meinungen vertreten und den deliberativen Prozess bewusst untergraben?
In seinem Beitrag stellte Paul Weithman fest, dass deliberative Demokratien durch den Prozess gemeinsamer argumentativer Abwägung auf Wahrheit abzielen. Entsprechend besorgniserregend sei die Tendenz vieler Teilnehmer*innen an deliberativen Prozessen in liberalen Gesellschaften – besonders in der Medienlandschaft – Gleichgültigkeit oder gar Verachtung gegenüber der Wahrheit zu zeigen, wie es insbesondere während der COVID-Pandemie zu beobachten war. Wie bewährte Methoden zur Wahrheitsfindung in Zweifel gezogen werden, illustrierte Weithman anhand des Beispiels von Fox News-Moderatorin Laura Ingraham, die hinsichtlich klinischer Studien zur Wirksamkeit von Hydroxychloroquin zur Heilung von COVID erklärte: „they want a double-blind controlled study on whether the sky is blue.“
Besonders in Krisensituationen sind Gesellschaften auf das Gelingen deliberativer, wahrheitsorientierte Prozesse angewiesen, um konsensuale Lösungen zu finden. Vor diesem Hintergrund scheint die politische Wende von Rawls‘ für einige Kritiker*innen problematisch: infolge der Bürden der Urteilskraft (burdens of judgment) müsse das Prinzip liberaler Legitimität ohne den Wahrheitsbegriff auskommen und die Vernunft an seine Stelle setzen. Ein Bezug zur Wahrheit stehe damit auch in deliberativen Prozessen nicht zur Verfügung, womit Rawls der Polarisierung, die wir derzeit beobachten können, Vorschub geleistet habe.
Gegen diese Lesart setzte Weithman seine eigene, nach der Bürger*innen durchaus Behauptungen aus ihren umfassenden Doktrinen (comprehensive doctrines) einbringen dürfen, die sie für wahr halten – vorausgesetzt, dass diese Behauptungen dem Kriterium öffentlicher Rechtfertigung genügen und sie das nachvollziehbar machen können. Abseits der Debatte um Rawls betonte Weithman den Wert von Fachwissen für deliberative Prozesse im Allgemeinen, der von sozialen Medien und der Tendenz bedroht sei, begründetes Wissen mit Meinungen gleichzusetzen. So schlug er den Bogen zu den praktischer ausgerichteten Fragen der Konferenz.
Ausdrücklich in den Vordergrund traten die praktischen Dimensionen hingegen beim Vortrag von Gabriele Badano. Er widmete sich der Eindämmung unvernünftiger Sichtweisen wie jenen von Unterstützern rechtspopulistischer Parteien. Weder staatliche, repressive Interventionen wie die Beschränkung grundlegender Freiheiten, noch sanftere Maßnahmen wie politische Bildung genügten, um die Ausbreitung der Unvernunft zu stoppen. Aus diesem Grund formulierte er eine an die vernünftige Bevölkerung gerichtete Pflicht zur Ausübung von Druck auf die Unvernünftigen. Als frühe Maßnahme sei eine solche Pflicht erfolgversprechend. In einem Ausflug in empirische Gefilde wurden von ihm rhetorische Werkzeuge wie die Nutzung von Analogien oder die Referenz zu geteilten Autoritäten eingeführt, die von vernünftigen Bürger*innen in der Ausübung ihrer Pflicht genutzt werden können. Es scheint fraglich, wie zuverlässig derlei rhetorische Werkzeuge den Kampf gegen Rechtspopulismus vorantreiben können. Jedoch stellten sie nach Badano neben den bereits angesprochenen staatlichen Interventionen lediglich einen ergänzenden Teil von Eindämmungsmaßnahmen dar, welche aus Sicht des politischen Liberalismus legitim wären. Weitere nicht-staatliche Akteure wie Parteien und Gemeinden könnten ebenso dazu beitragen.
James Boettcher betrachtete in Anlehnung an das Denken von Judith Shklar in seinem Vortrag die Kehrseite der rawls‘schen Tugenden in Form von Lastern, welche Bürger*innen an der Ausübung ihrer Vernunft hindern können. Eine Behandlung politischer Laster solle Teil einer vernünftigen, politischen Konzeption von Gerechtigkeit sein, weil sich Bürger*innen so der besonders bedenklichen Laster bewusst werden und sich darum bemühen können, sie zu vermeiden. Dafür charakterisierte er politische Laster – u.a. Vorurteile, Intoleranz und Grausamkeit – als praktisch-politisch oder epistemisch-politisch und verband sie jeweils mit einer der Bürden der Urteilskraft.
In ihrem Vortrag stellte Sharon Lloyd die Frage, ob Rawls‘ Pflicht zur Bürgerlichkeit von Bürger*innen verlange, auf der Grundlage von Gerechtigkeitsprinzipien und nicht auf der Basis von Eigeninteresse zu handeln. Auf der Suche nach einer Antwort setzte sie sich mit G.A. Cohens These auseinander, nach der eine Gesellschaft nur dann gerecht sein könne, wenn persönliche Entscheidungen ein verinnerlichtes egalitäres Ethos widerspiegelten. Letztlich, so schloss Lloyd, überzeuge Cohens These nicht. Rawls demonstriere mit dem Bild der wohlgeordneten Gesellschaft, dass Gerechtigkeit als Fairness befreiend sei, weil er die Menschen im Gegensatz zu Cohen so nehme, wie sie seien: rational, vernünftig und eigeninteressiert. Zwar setzte sich der Vortrag von den eher praktisch orientierten anderen Vorträgen ab, doch ergibt sich auch nicht aller Tage die Gelegenheit, mit Sharon Lloyd und Paul Weithman zwei ehemalige Doktorand*innen von Rawls über Rawls und sein Werk diskutieren hören zu können.
Bürgerlichkeit, Tugend und Bildung im digitalen Zeitalter
Idealtheorie stellt bei Rawls den Versuch dar, das Bild einer von perfekter Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft zu zeichnen. Dafür arbeitet er mit zwei idealisierenden Annahmen. Zum einen folgen alle Bürger*innen den der Gesellschaft zugrundeliegenden Gerechtigkeitsprinzipien. Zum anderen bestehen für Demokratien günstige historische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen. Als realistische Utopie kann eine solche Idealtheorie uns Orientierung unter nicht-idealen Bedingungen geben, indem sie ein Ziel darstellt, auf das es hinzuarbeiten gilt. Der Weg zu diesem Ideal, in dem die Bevölkerung bspw. ihre Pflicht zur Bürgerlichkeit anerkennt, ist angesichts eines sich ständig im Wandel befindlichen gesellschaftlichen Kontextes gerade im digitalen Zeitalter jedoch alles andere als offenkundig. Entsprechend vielschichtig fielen auch jene Vorträge aus, die sich der Skizzierung eines solchen Weges widmeten.
Valentina Gentile nahm sich der der Pflicht zur Bürgerlichkeit an, um ihr ihre gebührende Rolle in kontemporären liberalen Demokratien zuzuweisen. Die Existenz des Pluralismus religiöser wie moralischer Doktrinen begründet für Rawls die moralische Pflicht zur Bürgerlichkeit. Diese besagt, dass die Bevölkerung und sie vertretende Regierungsbeamte ihre Positionen in öffentlichen Foren durch die politischen Werte der öffentlichen Vernunft – sprich: durch freistehende, allen vernünftigen Bürger*innen zugängliche Gründe – rechtfertigen sollten, wenn sie über grundlegende Fragen der Gerechtigkeit und der Verfassungsmäßigkeit beraten. Diese Verpflichtung wirkt also als Begrenzung der öffentlichen Deliberation und basiere, so Kritiker*innen, auf einer homogenen Konzeption meist weißer, männlicher Bürger, die sich leicht auf politische Werte einigen könnten. Die Pflicht zur Bürgerlichkeit drohe so zum Mittel der Ausgrenzung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu werden, wenn deren Forderung nach Einbeziehung als Nichteinhaltung der Bürgerlichkeit abgewiegelt werden könne.
Gegen diese Tendenzen entwarf Gentile eine spezifisch politisch-liberale Konzeption von Bürgerlichkeit als pro-soziale Disposition des ‚sich aufeinander Einlassens‘, die die Einhaltung der Normen der Bürgerlichkeit beinhaltet, aber ebenso ein ausdrückliches Bemühen um die Rücksichtnahme auf andere. Eine plausible Interpretation von Bürgerlichkeit könne in der realen Welt nicht von historisch verwurzelten Praktiken isoliert werden, die allgemein akzeptiert sind. Eine solche ‚Kultur der Bürgerlichkeit‘ gehe der Pflicht zur Bürgerlichkeit gewissermaßen voraus: in nicht-öffentlichen Bereichen würden Normen der Bürgerlichkeit als prä-politischer Konsens kultiviert und somit die Grundlage für öffentliche Deliberation gelegt, die die langfristige Stabilität liberaler Demokratien verstärke. Unklar blieb dem Verfasser, inwiefern dies benachteiligten Gruppen in ihrem Kampf um Anerkennung und Aufmerksamkeit hilft, wenn der prä-politische Konsens doch in real existierenden Gesellschaften allzu oft auf bspw. patriarchalischen Ideen basiert. Wer reguliert diese Kultur dann derart, dass sie der normativen Anforderung entspricht, nicht im Widerspruch zu grundlegenden Werten und Ideen zu stehen, die eine vernünftige politische Auffassung von Gerechtigkeit unterstützen? Auch wenn einige Fragen offenblieben, präsentierte Gentile einen vielversprechenden Ansatz, die Vorbedingungen zu Rawls Pflicht zur Bürgerlichkeit unter nicht-idealen Bedingungen zu untersuchen, um reale Gesellschaften näher an ihre wohlgeordnete Variante heranrücken zu können.
Auch Julian Culp untersuchte die Vorbedingungen der Bürgerlichkeit, legte den Fokus aber auf dafür notwendige Reformen der Bildungsinstitutionen. Er argumentierte, dass die Veränderung der politischen Öffentlichkeit von einer massenmedialen zu einer vernetzten Kommunikationsumwelt auch eine Veränderung hinsichtlich staatsbürgerlicher Bildungsmaßnahmen zur Folge haben sollte. Moderne Ansätze beschränkten sich lediglich darauf, Bürger*innen zu lehren, die neuesten Instrumente politischer Kommunikation – zuvorderst Social Media – effektiv zu nutzen. Damit würde jedoch die kulturelle Dimension der Bürgerschaft vernachlässigt. Öffentlicher politischer Kultur käme sowohl eine konstitutive wie auch erzieherische Rolle in deliberativen Demokratien zu, weshalb die Ziele demokratischer Erziehung vor dem Hintergrund einer digitalisierten Öffentlichkeit neu bewertet werden müssten. Demokratische Bildung müsse auch die Art und Weise miteinbeziehen, wie die politische Kultur geformt wird.
Roberto Luppi formulierte vor dem Hintergrund zunehmender Individualisierung in liberalen Gesellschaften die Frage, ob die in westlicher Tradition beschriebene Rolle des idealen, inmitten der Agora deliberierenden Bürgers noch zeitgemäß sei. Ausgehend von einer Analyse kontemporärer gesellschaftlicher Bedingungen, in denen Gelegenheiten des kollektiven Austauschs zunehmend rar werden, stellte er die bei Rawls als richterlich bezeichneten Tugenden in den Vordergrund. Diese, so Luppi, könnten Individuen auch abseits jener kollektiven Verständigungsprozesse dazu befähigen, gerecht zu handeln.
Ebenfalls im Zentrum stand das digitale Zeitalter im Beitrag von Karoline Reinhardt, die die Grundlage für eine weitere Untersuchung der Rolle von Vertrauen in der KI-Ethik legte. Unter Bezugnahme auf Nussbaums Theorie politischer Emotionen und der Bedeutung von Vertrauen für Stabilität aus den richtigen Gründen bei Rawls demonstrierte sie, dass Vertrauen eine politische Emotion ist. Gerade hinsichtlich der Verbreitung und Manipulation von Informationen spiele Vertrauen eine große Rolle, doch leide die jüngste KI-Vertrauensdebatte an einer fehlenden Analyse der politischen Implikationen, die aus der Bezugnahme auf Vertrauen resultierten.
Allem voran zeigt die Vielfalt der Beiträge, dass der theoretische Weg von idealen zu existierenden Gesellschaften – und der praktische von existierenden zu idealen – alles andere als gerade verläuft. Wenn Rawls also keine direkten Lösungen bereithält, so inspiriert und leitet sein Werk doch zumindest weiterhin die Suche nach der bei ihm vielbeschworenen Stabilität liberaler Gesellschaften. Es bleibt zu hoffen, dass andere derzeit populäre Beschwörungen damit bald der Vergangenheit angehören werden.
Full disclosure: Die Beiträge auf der Konferenz wurden von vorab zugewiesenen Teilnehmer*innen kurz kommentiert. Der Verfasser dieses Beitrages hat einen strukturierten Kommentar zu dem Beitrag von Gabriele Badano präsentiert.
Daniel Beck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund. In seiner Promotion untersucht er die Entwicklung gegenseitigen Respekts in Kollektiven als Vorbedingung der Stabilität liberaler, pluralistischer Gesellschaften und welche Form von Liberalismus damit korrespondiert.
Im Rahmen der Konferenz hat Dr. Sarah Rebecca Strömel ein kurzes Interview mit Prof. Dr. S.A. Lloyd (University of Southern California) und Prof. Dr. Paul Weithman (University of Notre Dame) geführt:




