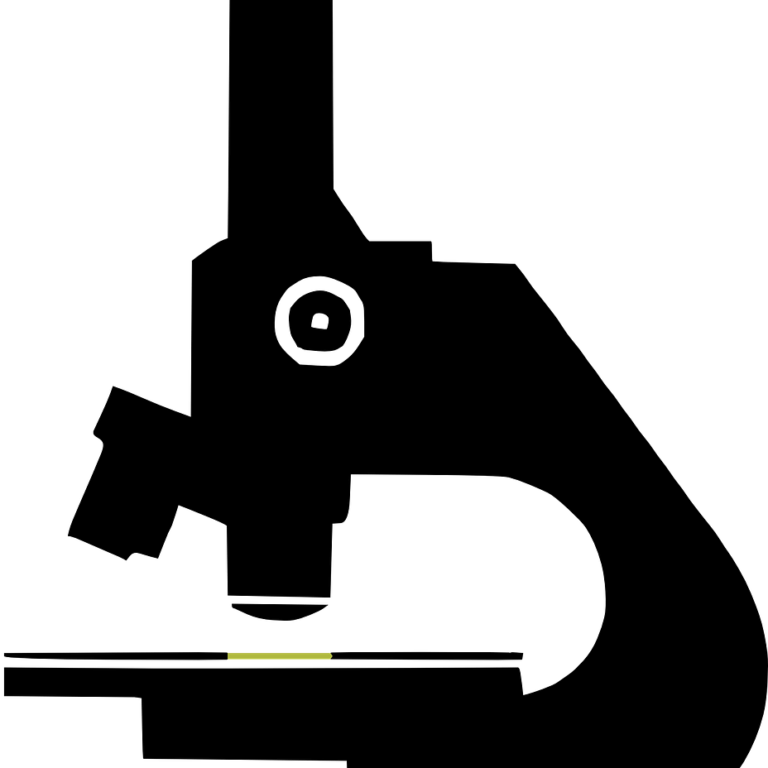Das Überlegungsgleichgewicht – Was genau ist das?
Von Georg Brun (Bern)
Eine Ethikerin vertritt das Prinzip Die Interessen aller Personen zählen gleich. Aber sie glaubt auch, es sei erlaubt, die eigenen Kinder bevorzugt zu behandeln. Das ist ein Problem: ihre Überlegungen sind nicht im Gleichgewicht, weil das Prinzip und ihr intuitives Urteil über Einzelfälle nicht übereinstimmen. Begründete Positionen verlangen aber ein Überlegungsgleichgewicht – so eine populäre Auffassung in der Ethik. Doch wie soll die Idee des Gleichgewichts genau verstanden werden? Das will dieser Beitrag erklären.
1. Woher die Idee des Überlegungsgleichgewichts kommt
Die Idee des Überlegungsgleichgewichts wurde erstmals 1954 von Nelson Goodman im Zusammenhang mit Grundlagenfragen der Logik beschrieben. Die Bezeichnung „Überlegungsgleichgewicht“ (reflective equilibrium) stammt aber aus Rawls’ Klassiker Eine Theorie der Gerechtigkeit von 1971. Rawls verlangte, dass wir Prinzipien der Gerechtigkeit begründen, indem wir Vorschläge für solche Prinzipien und unsere moralischen Urteile wechselseitig aneinander anpassen, bis wir ein kohärentes Ganzes erreicht haben. Werden Ethiker heute gefragt, wie sie ihre Theorien begründen, antworten sie gerne mit dem Überlegungsgleichgewicht – und noch öfter verweisen sie auf das Überlegungsgleichgewicht, wenn man sie fragt, weshalb man intuitive moralische Urteile überhaupt ernst nehmen sollte.
Das Überlegungsgleichgewicht ist übrigens keine Begründungsmethode spezifisch für die Ethik. Einige Philosophen, am prominentesten David Lewis, verteidigen es für die Philosophie insgesamt, und Catherine Elgin arbeitet seit fast 40 Jahren an einer allgemeinen Erkenntnistheorie, in der das Überlegungsgleichgewicht eine zentrale Rolle spielt. Auf ihre Arbeit stütze ich mich in erster Linie, beschränke mich aber auf die Ethik.
2. Wie das Überlegungsgleichgewicht im Kern zu verstehen ist
Es gibt viele mehr oder weniger unterschiedliche Beschreibungen des Überlegungsgleichgewichts, aber zwei Elemente sind immer zentral: Ein Zielzustand, in dem moralische Urteile und Prinzipien übereinstimmen, und ein Prozess, in dem moralische Urteile und Prinzipien wechselseitig aneinander angepasst werden.
Der Prozess ist notwendig, weil der Versuch, die gegebenen Urteile durch Prinzipien zu erfassen, in aller Regel zu Unstimmigkeiten führt: aus den Prinzipien folgt etwas, das nicht zu den Urteilen passt, oder die Prinzipien erfassen nicht alle Urteile. Dann müssen Urteile oder Prinzipien angepasst werden. Wenn zum Beispiel der Ethiker Alf viele seiner wichtigsten moralischen Urteile durch das Prinzip Die Interessen aller Personen zählen gleich erfassen kann, spricht das dafür, dass er unklare Fälle mit Hilfe dieses Prinzips beurteilt und unsichere Urteile korrigiert, wenn sie nicht zum Prinzip passen. Oder es tauchen neue Fälle auf, die Alf so beurteilt, dass er sich gedrängt sieht, das Prinzip aufzugeben, es zu modifizieren oder ein weiteres Prinzip dazuzunehmen. Erst wenn Alf Prinzipien gefunden hat, die mit allen seinen Urteilen zusammenpassen, können diese Prinzipien und Alfs Urteile als gerechtfertigt gelten.
Dieses Bild des Überlegungsgleichgewichts lebt von einem Kontrast zwischen Urteilen und Prinzipien. Dabei werden Prinzipien als allgemeine Aussagen darüber, was moralisch geboten, erlaubt oder verboten ist, verstanden; Urteile hingegen als Aussagen, die sich auf das Handeln in einer konkreten Situation beziehen. Das ist aber ein Missverständnis.
Dass der Gegensatz zwischen allgemeinem Prinzip und Einzelfallurteil nicht den wesentlichen Punkt trifft, zeigt sich schon darin, dass gegen ein ethisches Prinzip auch allgemeine Urteile sprechen können und dass ethische Prinzipien auch allgemeine Urteile systematisieren können. Gegen das Prinzip Die Interessen aller Personen zählen gleich spricht ja nicht primär das Einzelfallurteil, dass Alf das Recht hatte, beim Brand gestern zuerst seinen Sohn Cédric zu retten, sondern noch mehr das allgemeine Urteil, dass alle das Recht haben, die eigenen Kinder vorzuziehen.
Aber natürlich muss es einen Unterschied zwischen Urteilen und Prinzipien geben, damit die Forderung, Urteile und Prinzipien aneinander anzupassen, Sinn ergibt. Doch der Unterschied besteht in der Funktion, die eine Aussage für eine Person hat. Urteile sind Aussagen, auf die sich eine Person festlegt, die sie, wenigstens zu einem gewissen Grad, akzeptiert. Prinzipien sind dagegen Aussagen, die als Bestandteile ethischer Theorien verwendet werden. Sie haben die Funktion, Festlegungen zu systematisieren. Auch wenn Alf nicht auf die Aussage Die Interessen aller Personen zählen gleich festlegt ist, kann er sie als Prinzip verwenden und versuchen herauszufinden, wie gut er damit seine Festlegungen systematisieren kann.
Halten wir fest: das Überlegungsgleichgewicht verlangt, dass wir durch wechselseitiges Anpassen ein Gleichgewicht im Sinne einer Balkenwaage erreichen: aus der Theorie folgt genau das, worauf wir uns festlegen.

3. Wieso das Überlegungsgleichgewicht nicht auf Intuitionen beruht
Viele Ethikerinnen verstehen das Überlegungsgleichgewicht intuitionistisch, weil sie die moralischen Festlegungen als intuitive Urteile verstehen. Das ist ein zweites Missverständnis.
Was Intuitionen genauer sind, ist umstritten, aber über Folgendes besteht Einigkeit: Wenn eine Person sich auf etwas ausschließlich deshalb festlegt, weil sie es bewusst logisch erschlossen hat, dann ist das keine Intuition. Nichts in der Methode des Überlegungsgleichgewichts schließt aber aus, dass Festlegungen logisch erschlossen werden. Im Gegenteil, es ist damit zu rechnen, dass eine Ethikerin nur dann einen Zustand des Überlegungsgleichgewichts erreichen kann, wenn sie bereit ist, sich auf einiges einfach deshalb festzulegen, weil es aus der ethischen Theorie folgt. Das Überlegungsgleichgewicht schließt aber auch nicht aus, dass Ethikerinnen von intuitiven Urteile ausgehen – oder von Festlegungen, die sie aus expliziten vortheoretischen Überlegungen ableiten.
Das alles heißt nicht, dass Intuitionen in der Ethik nicht wichtig sind. Vielleicht sind sie es. Aber selbst wenn sich zeigen ließe, dass sie unverzichtbar sind, könnte der Grund dafür nicht einfach darin bestehen, dass Begründungen in der Ethik ein Überlegungsgleichgewicht erfordern.
4. Weshalb das Überlegungsgleichgewicht mehr als Kohärenz verlangt
Die für den Zielzustand geforderte Übereinstimmung von Festlegungen und Theorie lässt sich als Kohärenz verstehen. Festlegungen und Theorie sollen keine Widersprüche enthalten und sich gegenseitig stützen. Dazu kommt die erweiterte Kohärenz mit relevanten Hintergrundtheorien, etwa Theorien über kognitive Fähigkeiten oder biologische Bedürfnisse von Menschen und anderen Tieren. Viele Ethiker denken deshalb, es gehe beim Überlegungsgleichgewicht einfach um Kohärenz. Das ist ein drittes Missverständnis.
Tatsächlich ist die bisherige Beschreibung des Überlegungsgleichgewichts unvollständig. Noch schließt nichts aus, dass sich ein Überlegungsgleichgewicht auf beinahe triviale und sicher absurde Weise erreichen ließe. Weil jede Festlegung und jedes Prinzip revidierbar ist, könnte Alf sich einfach dazu entscheiden, alle seine Festlegungen aufzugeben und sich stattdessen auf alles festzulegen, was aus einer beliebigen kohärenten Theorie folgt, die Beth vorschlägt. Oder er könnte genau soviel von seinen Festlegungen aufgeben, wie nötig ist, um sie kohärent zu machen, und dann diese Liste von Festlegungen als seine Theorie ausgeben.
Würde Alf aber seine moralischen Festlegungen so wenig ernst nehmen, dass er bereit wäre, sie beliebig zu revidieren, hätte er keinen Grund mehr, zu glauben, Beths Theorie sei tatsächlich eine ethische Theorie. Wer moralische Fragen zum Beispiel auf der Grundlage des Recht des Stärkeren oder rein ökonomischer Überlegungen beantwortet, hat das Gebiet der Moral verlassen. Deshalb müssen wir verlangen, dass der Anpassungsprozess die anfänglichen Festlegungen insofern respektiert, als wir Revisionen in passender Weise erklären können. Zum Beispiel, indem wir darauf hinweisen, dass eine Festlegung einem Prinzip widersprach, das zu stärkeren Festlegungen passt.
Das zweite Problem ist, dass eine kohärente Liste von Festlegungen im Allgemeinen noch keine Theorie darstellt. Der entscheidende Unterschied ist, dass Theorien systematisch sein müssen. Systematizität lässt sich durch Verweis auf „Tugenden“ von Theorien erklären. Dazu zählen in der Ethik zum Beispiel, dass eine Theorie einfach ist, auf viele konkrete Handlungen angewendet werden kann und informative moralische Urteile liefert. Solche Tugenden können unterschiedlich gewichtet und gegeneinander abgewogen werden, je nachdem welchem Ziel die ethische Theoriebildung letztlich dienen soll. Zum Beispiel sind in der Medizinethik genaue Handlungsanweisungen für konkrete Fälle wichtiger als Anwendbarkeit auf alle ethischen Bereiche, wogegen eine umfassende Theorie der Gerechtigkeit vor allem auf ein möglichst einfaches und allgemeines Prinzip abzielen mag.
Halten wir fest: das Überlegungsgleichgewicht verlangt, dass wir ein zweites Gleichgewicht realisieren, ein Gleichgewicht zwischen zwei Kräften wie beim Seilziehen: die „konservative“ Anziehungskraft der anfänglichen Festlegungen und die „progressive“ Anziehungskraft der Systematizität gleichen sich aus.

5. Was das Überlegungsgleichgewicht insgesamt beinhaltet
Das Überlegungsgleichgewicht kann man sich also als Resultat eines Prozesses vorstellen, der von den vorhandenen moralischen Festlegungen ausgeht und diese in wechselseitiger Anpassung mit theoretischen Vorschlägen revidiert. Ein Überlegungsgleichgewicht erreicht zu haben, bedeutet, moralische Auffassungen zu akzeptieren, die theoretisch respektabel sind und die anfänglichen Festlegungen respektieren. Sie sind theoretisch respektabel, wenn sie mit einer systematischen Theorie übereinstimmen und durch relevante Hintergrundtheorien gestützt werden. Die resultierenden Festlegungen respektieren die anfänglichen, wenn sich plausibel erklären lässt, warum die resultierenden von den anfänglichen abweichen, und zwar so, dass klar ist, dass die Theorie tatsächlich eine ethische ist.
Insgesamt verlangt das Überlegungsgleichgewicht also nicht bloß ein, sondern zwei Gleichgewichte: die grüne Übereinstimmung von Festlegungen und Theorie, und den roten Ausgleich zwischen anfänglichen Festlegungen und Systematizität.

Georg Brun ist Professor für Philosophie an der Universität Bern. Leitend für seine Forschung und Lehre ist ein starkes Interesse an philosophischen Methoden der Begriffsentwicklung und der Argumentationsanalyse, zur Zeit besonders im Zusammenhang mit Fragen der Erkenntnistheorie. Zum Überlegungsgleichgewicht leitet er zusammen mit Claus Beisbart und Gregor Betz das vom SNF und der DFG geförderte Forschungsprojekt How Far Does Equilibrium Take Us? Investigating the Power of a Philosophical Method. Auf Ergebnisse aus diesem und einem Vorgängerprojekt stützt sich dieser Beitrag.
Literatur
Klassiker:
Goodman, Nelson. 1983 [1954]. Fact, Fiction, and Forecast. 4th ed. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dt. 1975 Tatsache, Fiktion, Voraussage. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press. Revised ed. 1999. Dt. 1975. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Elgin, Catherine Z. 1996. Considered Judgment. Princeton: Princeton University Press. Dt. Auszug: 2003. Erkenntnistheoretisches Gleichgewicht. In Vogel, Matthias; Lutz Wingert (Hg.). Wissen zwischen Entdeckung und Konstruktion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 193–217.
Mehr zum hier beschriebenen Verständnis des Überlegungsgleichgewichts:
Baumberger, Christoph; Georg Brun. 2016. Dimensions of Objectual Understanding. In Grimm, Stephen R.; Christoph Baumberger; Sabine Ammon (eds). Explaining Understanding. New Perspectives from Epistemology and Philosophy of Science. New York: Routledge. 165–89.
Baumberger, Christoph; Georg Brun. 2020. Reflective Equilibrium and Understanding. Synthese. doi: 10.1007/s11229-020-02556-9.
Brun, Georg. 2012. Podcast zum Überlegungsgleichgewicht.