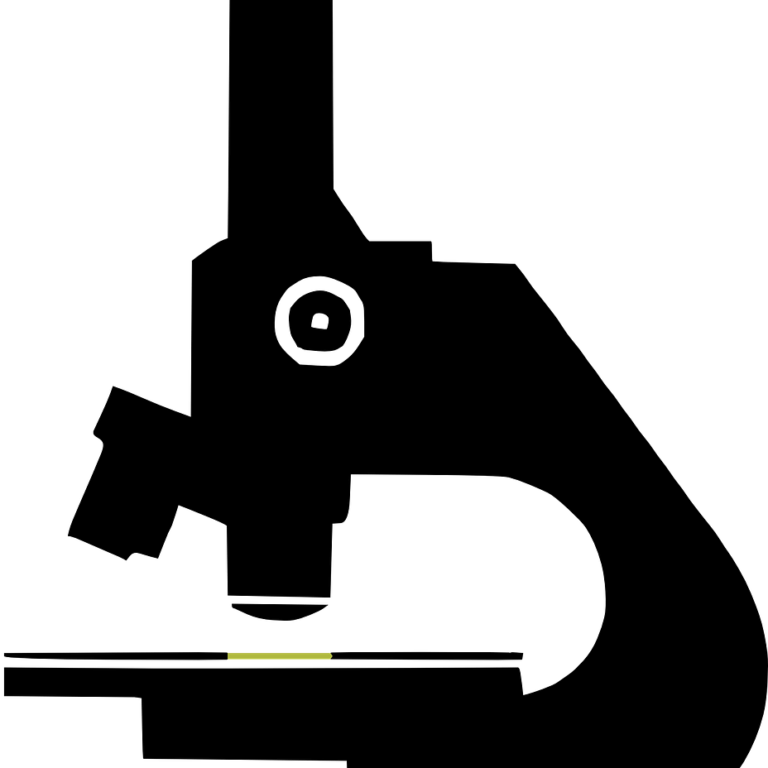Plädoyer für die Utopie. Notwendig und unverzichtbar als Philosophie des Wünschenswerten und Möglichen
Von Mathias Lindenau (Ostschweizer Fachhochschule)
Stellen Sie sich vor, man würde Sie um eine Stellungnahme bitten, ob die Utopie irgendeine Relevanz für die Philosophie besitzt. Möglicherweise würde Ihnen Shakespeares Komödie «Viel Lärm um nichts» in den Sinn kommen und Sie würden achselzuckend Ihrer Meinung nach lieber einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen. Aber vielleicht würden Sie doch einen Moment innehalten und sich fragen, ob Philosophie als die Inkarnation logischen Denkens überhaupt etwas mit Utopien zu tun haben kann, die bekanntlich im Ruf stehen, nach einem Wolkenkuckucksheim zu suchen.
Und in der Tat: Alle, die in Utopien mehr sehen als unrealistische Annahmen, übersteigertes Wunschdenken oder praktische Erfolglosigkeit müssen damit rechnen, schnell diskreditiert zu werden; in der Wissenschaft und Philosophie ebenso wie auch im Alltag. Zeugnis davon gibt folgendes Bonmot, das vom Alt-Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, stammen soll: «Wer Visionen hat, geht zum Arzt.» Mit dieser Ansicht war Schmidt keineswegs allein. Unter Berufung auf eine illusionäre Realitätskonstruktion wird der Utopie oft unterstellt, uneinlösbare Ansprüche zu formulieren, an der sie schließlich scheitern muss.
Dieses Argumentationsmuster findet sich auch in der Philosophie und entsprechend mit ihm Stimmen, die die Utopie und mit ihr utopisches Denken diskreditieren. Im Wesentlichen wird hierbei entweder auf die angebliche Unbedarftheit von Utopien verwiesen, die als eine Art Weltflucht eingeschätzt werden. Oder die Orientierung an Utopien und utopischem Denken wird als fahrlässig und gefährlich eingestuft, da ihre Realisierungsversuche fast immer in ihr gefürchtetes Gegenteil, die Dystopien, umschlagen, und so die unerwünschten oder möglichen Folgen nicht hinreichend bedenken. Schließlich wird argumentiert, dass Utopien und utopisches Denken aufgrund ihres inhärenten epistemischen Defizits den Blick für die realen Gegebenheiten verstellt. Etwa, weil sie vermeintlich ein unwissenschaftlicher Charakter auszeichnet. Oder ihnen wird ein ideologischer Gehalt unterstellt, in dem sie uns, ganz im wörtlichen Sinn der Hauptstadt Utopias, Amaurotum (Nebelstadt), die Sinne benebeln und uns über die Wirklichkeit täuschen.
Der Begriff Utopie ist damit zu einem Reizwort geworden. Aber auch die Utopien selbst haben an dieser Diskreditierung einen wesentlichen Anteil: Der Glaube, mit einem intellektuell ausgearbeiteten Plan ein perfektes System in der Gesellschaft installieren zu können, das dann allen humanistischen Idealen genügen würde, offenbarte nur allzu oft die inhärenten Denk- und Konstruktionsfehler. Doch Utopien allein auf diesen Typus zu reduzieren hiesse, das Kind mit dem Bade ausschütten. Was aber kennzeichnet die so verschriene Utopie eigentlich?
Vereinfacht formuliert sind Utopien im hier verstandenen Sinne keine religiösen Erlösungserwartungen, keine chiliastischen Durchbruchserlebnisse, aber auch keine illusionären Vorstellungen einer traumhaft-fantastischen Welt. Sie sind zunächst einmal rationale Entwürfe, die danach fragen, was an gesellschaftlichen Verhältnissen geändert werden muss und wie sich diese zum Besseren hin entwickeln ließen. Entsprechend implizieren Utopien, wie schon bei ihrem Namensgeber Thomas Morus, neben ihrem Idealentwurf immer auch eine Sozialkritik, auf der sie aufruhen.
Ersichtlich befasst sich eine Utopie deshalb nicht allein mit dem ou-tópos, dem Nicht-Ort als Ausdruck für den Ort, den es geben müsste, sondern immer auch mit dem eu-tópos, dem guten Ort. Ein anderer Begriff dafür ist das bonum commune. Und die Suche danach, was dieses gute Gemeinwesen auszeichnen sollte, ob und wenn ja, wie es sich verwirklichen lässt und was dabei auch ungelöst bleibt, beschäftigt die Philosophie seit tausenden von Jahren. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit sind nur die prominenten Schlagwörter, die uns auch heute noch – und in der gegenwärtigen Zeit mit neuer Intensität – umtreiben: Was kennzeichnet ein gutes Gemeinwesen für alle, auch global betrachtet? Bis zu welchem Punkt darf die individuelle Freiheit zu Gunsten der Gerechtigkeit eingeschränkt werden? Oder steht die individuelle Freiheit über allem? In welcher Hinsicht sind Menschen gleich und welche Forderungen lassen sich daraus ableiten?
Die Utopie besitzt damit eine Kritikfunktion gegenüber der etablierten Gesellschaft in Form des regulativen Prinzips: Sie will die Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was möglich wäre, aufzeigen und sucht nach Möglichkeiten, bestehende Defizite zu kompensieren oder über, als vermeintlich nicht verbesserbare, gesellschaftliche Zustände hinaus zu denken und Handlungsperspektiven zu eröffnen. So besehen ist «[h]umanes Zusammenleben [..] ohne Utopien gar nicht denkbar».[1]
Es war der in Vergessenheit geratene Gustav Landauer,[2] der einprägsam diese Funktion der Utopie als erster herausgearbeitet hat. Nicht in der Verwirklichung einer perfekten oder idealen Gesellschaft besteht die Funktion von Utopien, sondern in der Suche nach dem Noch-Nicht-Bestehenden, aber Möglichen und Machbaren. Sie ist Katalysator der gesellschaftlichen Entwicklung, indem sie die gesellschaftliche Realität immer wieder konfrontiert und dadurch fortlaufend verändert: Ähnlich wie eine Asymptote sich einem Kreis immer weiter annähert, ohne diesen jemals berühren zu können, so nähert sich die Utopie in einem nie endenden Prozess immer weiter dem Ideal an, in dem Wissen, es nie ganz erreichen zu können.
Utopisches Denken ist somit nicht illusorisch und unreflektiert, sondern beruht im Gegenteil auf Rationalität: Es fragt nach dem Wünschenswerten, sucht nach dem Möglichen, prüft das Machbare. Utopisches Denken zwingt zur Infragestellung vermeintlicher Gewissheiten und angeblicher Alternativlosigkeit ebenso, wie zur Auseinandersetzung mit der Widerständigkeit praktischer Probleme und Herausforderungen. Es ist ein Denken im Konjunktiv (Alexander Kluge) und in Alternativen zum Bestehenden. Und wer, wenn nicht die Philosophie und die Menschen, die sie betreiben, sind dazu aufgerufen, frei zu denken? Utopien und utopisches Denken sind folglich unverzichtbar für die praktische Philosophie. Denn sie kann sich nicht allein in die Welt abstrakter Theorien zurückziehen, sondern von ihr werden ebenso Antworten und Überlegungen zu praktischen Problemen erwartet; keine Rezepte, aber Denkanstöße. Und das umfasst eben auch, das Wünschenswerte und das Mögliche verfügbar zu machen; für den akademischen Diskurs ebenso wie für den gesellschaftlichen.
Nicht in jedem Fall wird das Wünschenswerte auch das Mögliche sein, und aus dem Möglichen wiederum muss nicht zwingend das Machbare folgen. Aber die Suche nach dem Möglichen ist unverzichtbar, um das Machbare bestmöglich zu bestimmen zu versuchen. Oder, in den Worten von Max Weber formuliert, bestätigt «alle geschichtliche Erfahrung […], daß man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre.»[3]
Mathias Lindenau ist Professor an der Ostschweizer Fachhochschule und befasst sich am dortigen Zentrum für Ethik und Nachhaltigkeit mit Fragestellungen und Herausforderungen der Angewandten Ethik. Gegenwärtig forscht er zur politischen Figur des Parasiten.
[1] Julian Nida-Rümelin. 2011. Utopie zwischen Rationalismus und Pragmatismus. In: Ders./Klaus Kufeld (Hrsg.): Die Gegenwart der Utopie. Zeitkritik und Denkwende. Freiburg i.Br./München: Alber, S. 26–45 (hier: S. 43).
[2] Gustav Landauer. 1907. Die Revolution (Die Gesellschaft. Bd. 13. hrsg. v. Martin Buber). Frankfurt a.M.: Rütten&Loening.
[3] Max Weber. 1996. Politik als Beruf. Stuttgart: Reclam, S. 82.