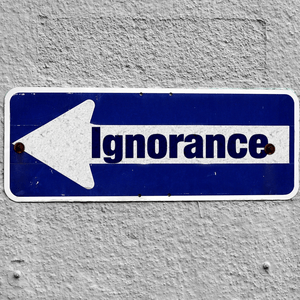
“Das wüsste ich aber!” Zur Ehrenrettung des argumentum ad ignorantiam
von Hans Rott (Regensburg)
1. Einleitung
In einer virtuellen Pressekonferenz am 30. März 2020 sagte Michael J. Ryan, der Direktor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle: “there is no specific evidence to suggest that the wearing of masks by the mass population has any particular benefit.” Dass es keine Indizien dafür gebe, die belegen, dass das Tragen von Masken für die von COVID-19 heimgesuchte Allgemeinheit etwas bringt, wurde allgemein so verstanden, dass das Maskentragen keinen Effekt hat. Es galt sozusagen als Bestätigung dessen, was Jerome Adams, der Surgeon General der USA, schon einige Wochen vorher getwittert hatte: “Seriously people – stop buying masks! They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus”. So verstanden erscheint Ryans Aussage als ein typisches Beispiel des sogenannten Fehlschlusses aus der Unwissenheit: Es gibt keine Beweise für den Nutzen von Masken, also nützen sie nichts. Wenn es anders wäre, dann wüsste ich das doch! Dass dies keine gute Schlussfolgerung war, ist uns allen heute klar.[1]
SENECA äußerte den Satz “Das wüsste ich aber” immer dann, wenn er anderer Meinung war als seine Dialogpartner, gelegentlich verbunden mit einer Weigerung, Wissenslücken zuzugeben. Der Satz wurde oft als Ausdruck der Persönlichkeit SENECAS angesehen. Tatsächlich führte allerdings wohl einfach ein fehlerhafter Balpirol-Halbleiter zu einem übersteigerten Selbstbewusstsein SENECAS. SENECA ist seit der Inbetriebnahme im Jahre 3540 die zentrale Hyperinpotronik des Fernraumschiffes SOL. Die Solaner schreiben dem Computer Intelligenz und eine Seele zu. So ist es jedenfalls in den vormals berühmten deutschen Perry-Rhodan– und Atlan-Serien.[2]
Im Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart gehört der Satz “Das wüsste ich aber” zu den Synonymgruppen von “Unsinn” und “i wo”. Wer den Satz äußert, weist etwas von Anderen Behauptetes vehement zurück. Im Forum zum deutsch-englischen Online-Wörterbuch Leo werden die Paraphrasen “Red’ keinen Unsinn”, “Ach, hör doch auf”, “Erzähl mir doch nichts” angeboten; ein Forumsteilnehmer namens “Erasmus” reflektiert aber auch über die Logik des Satzes. Mit der Logik des Satzes soll sich auch dieser Beitrag beschäftigen, und wir versuchen jetzt, das Problem etwas systematischer anzugehen. Der Satz
(1) Das wüsste ich aber!
steht im Konjunktiv. Damit wird offenbar angezeigt oder vorausgesetzt, dass der Sprecher oder die Sprecherin etwas nicht weiß – oder zumindest glaubt, es nicht zu wissen. Wenn wir den betreffenden nicht gewussten Sachverhalt mit der Aussage “p” bezeichnen, dann können wir sagen, dass der Satz (1) eine elliptische, idiomatisch kurze Ausdrucksweise ist für:
(2) Wenn das (=p) wahr wäre, dann wüsste ich, dass p.
Dies ist ein kontrafaktischer Konditionalsatz, denn p entspricht ja – zumindest nach Meinung des Sprechers – nicht den Fakten. Um die Interpretation, dass der Satz (1) eine lebhafte Art der Zurückweisung von p darstellt, angemessen nachzuzeichnen, bedarf es aber noch eines kleinen Arguments. Erstens bringt der Konjunktiv, wie gesagt, zum Ausdruck, dass der Sprecher nichtweiß, dass p. Zweitens kann man nun einen Satz verwenden, den man als Kontraposition des kontrafaktischen Konditionalsatzes (2) bezeichnen könnte:
(3) Da ich nicht weiß, dass p, ist p nicht wahr.
Oder, stilistisch vielleicht etwas weniger schön, aber die paradigmatische begründende Konjunktion “weil” verwendend,
(4) Weil ich nicht weiß, dass p, deshalb ist p nicht wahr.
Damit und mit der Voraussetzung, dass der Sprecher tatsächlich (weiß, dass er) nicht weiß, dass p, kann erschlossen werden, dass p nicht wahr ist. Das ist ein Schluss aus dem Nichtwissen, ein argumentum ad ignorantiam. Er erscheint einleuchtend genug. Andererseits wird das argumentum ad ignorantiam in Logikbüchern traditionell als Fehlschluss gebrandmarkt.[3] Im Folgenden möchte ich Überlegungen anstellen, ob es sich wirklich um einen Fehlschluss handelt.
Die lateinische Bezeichnung “argumentum ad ignorantiam” wurde wohl von John Locke eingeführt:
Ein zweites Mittel, das man häufig anwendet, um andern zuzusetzen und sie zu zwingen, ihre Meinung preiszugeben und sich der bestrittenen Ansicht anzuschließen, besteht darin, daß man dem Gegner zumutet, er solle entweder das, was man als Beweis anführt, anerkennen oder aber einen besseren Beweis erbringen. Dies nenne ich argumentum ad ignorantiam.[4]
Diese Strategie zielt auf die Unfähigkeit eines Opponenten in der Debatte, ein besseres Argument als man selbst abzugeben. Locke hält diese Art zu argumentieren für ein rhetorisches Mittel, das uns nicht zur Wahrheit führt, doch ist das noch nicht das, was heute üblicherweise mit dem Term “argumentum ad ignorantiam” bezeichnet wird.
In dem populären Logik-Buch von Irving Copi and Carl Cohen (1990, S. 93) heißt es, das argumentum ad ignorantiam sei
der Fehler, den man macht, wenn man argumentiert, dass eine Aussage wahr ist einfach deswegen, weil sie nicht als falsch erwiesen wurde, oder dass sie falsch ist, weil sie nicht als wahr erwiesen wurde.[5]
Copi und Cohen geben ein hübsches Beispiel für diesen Fehler. Als Galilei durch sein Fernrohr Berge auf dem Mond sah, entstand für das alte Weltbild ein großes Problem, denn als Himmelskörper hätte der Mond eine geometrisch perfekte Kugelform haben müssen. Im Jahr 1611 schloss deshalb der Florentiner Philosoph Lodovico delle Colombe, dass es eine durchsichtige, kristalline Substanz gebe, die die scheinbaren Berge des Mondes vollständig überdeckt und die apriorisch geforderte Kugelform wiederherstellt. Das Gegenteil war ja durch einen Blick ins Fernrohr nicht zu beweisen! Aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen, erwiderte Galilei, dass er den Punkt gerne zugebe ‒ sofern man ihm den Schluss gestatte, dass es auf dem Mond noch viel höhere (dreißigmal so hohe wie die irdischen!) Berge aus eben dieser durchsichtigen Substanz gebe. Das Gegenteil davon sei ja nicht zu erweisen! Es überrascht nicht, dass dem Einwand Lodovicos kein nachhaltiger Erfolg beschieden war.[6]
Einen ähnlichen Fehler vermutete Sigmund Freud (1927, S. 354f) bei den Verteidigern des religiösen Glaubens:
An dieser Stelle kann man auf den Einwand gefaßt sein: “Also, wenn selbst die verbissenen Skeptiker zugeben, dass die Behauptungen der Religion nicht mit dem Verstand zu widerlegen sind, warum soll ich ihnen dann nicht glauben, da sie soviel für sich haben, die Tradition, die Übereinstimmung der Menschen und all das Tröstliche ihres Inhalts?” Ja, warum nicht? So wie niemand zum Glauben gezwungen werden kann, so auch niemand zum Unglauben. Aber man gefalle sich nicht in der Selbsttäuschung, daß man mit solchen Begründungen die Wege des korrekten Denkens geht. […] Die Unwissenheit ist die Unwissenheit; kein Recht, etwas zu glauben, leitet sich aus ihr ab.
Freud verurteilt hier offenbar die “faule” Ausrede eines argumentum ad ignorantiam: Aus dem Nichtwissen über die Nichtexistenz Gottes darf nicht auf seine Existenz geschlossen werden. Aber ist die Anwendung des Arguments immer ein Fehler? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, worum es sich beim argumentum ad ignorantiam eigentlich genau handelt.
2. Das argumentum ad ignorantiam
Was ist die allgemeine Form eines Schlusses aus dem Nichtwissen (aus dem Unwissen, aus der Unwissenheit)? Oben habe ich mich auf diese Form bezogen:

In dieser Form ist das Argument nicht zu tadeln.[7] Auf den ersten Blick handelt sich um eine Instanz der gewöhnlichen, gültigen Schlussform des Modus Tollens. Auf den zweiten Blick wird deutlich, dass als erste Prämisse kein materialer, sondern ein konjunktivischer, kontrafaktischer Konditionalsatz fungiert, aber das erscheint unschädlich. Wenn dieses Argument angreifbar ist, dann liegt es nicht an seiner logischen Form, sondern an der ersten Prämisse, deren Wahrheit natürlich anfechtbar ist. (Dass auch die zweite Prämisse nicht immer gegen Kritik gefeit ist, werde ich im nächsten Abschnitt ansprechen.)
Wenn das Argument aber, wie weithin üblich, als Fehlschluss gebrandmarkt wird, wird es meistens in der folgenden Form angeführt:

Diese Form soll nicht als als Abkürzung (oder, wie man auch sagt, als Enthymem) für die Zwei-Prämissen-Form verstanden werden, denn sonst wäre sie – nachdem die Vervollständigung vorgenommen wurde – ja wieder gültig. Gemeint ist das Schema genauso, wie es dasteht. In dieser Form ist es sicher ungültig im Sinne der klassischen Logik: Die Wahrheit der Prämisse verbürgt nicht die Wahrheit der Konklusion.
Diese sozusagen “offizielle” Formulierung (B) des argumentum ad ignorantiam ist im Vollzugsmodus der ersten Person gefasst. Es wäre eigentlich noch zu klären, ob dies richtig und wichtig ist, aber diese Fragen möchte ich hier ausklammern.[8]
Häufig findet man auch die folgende Variante unter der Bezeichnung argumentum ad ignorantiam:[9]

Die Prämisse in (C) nimmt auf fehlende Beweise Bezug, also eine ganz spezifische Methode, Wissen zu erwerben. Diese Variante passt weniger gut zum Namen des Arguments, und sie stellt uns vor die schwierige Aufgabe, zu sagen, was genau denn als Beweis gelten kann. Ich konzentriere mich also auf die vorige, prototypische Version (B), die wir von nun an mit “AAI” bezeichnen.
3. Wissen über Wissen und Nichtwissen
Für die Anwendbarkeit des AAI ist es nötig, dass das Subjekt sein eigenes Wissen bzw. sein eigenes Nichtwissen kennt. Es ist also noch zu klären, ob dies überhaupt vorausgesetzt werden darf. Hierzu wollen wir Hilfe eines Amateurphilosophen in Anspruch nehmen, nämlich des kürzlich verstorbenen früheren amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Auf einer berühmt gewordenen Pressekonferenz im Jahr 2002 unterschied er
- known knowns,
- known unknowns und
- unknown unknowns.
Slavoj Žižek und Errol Morris, der eine Dokumentation über Rumsfeld drehte, fanden, er hätte auch die vierte denkbare Möglichkeit nennen sollen:
- unknown knowns.
Tatsächlich sind alle vier Kombinationen sinnvoll und von Interesse. Von vielen Wissensbeständen wissen wir, dass wir sie haben. Aber es gibt auch Wissen, dessen sich die Wissenden nicht bewusst sind, zum Beispiel bei Tieren (Hilary Kornblith), bei unsicheren Quizkandidaten (Colin Radford) und bei Personen, die etwas verdrängen, (Sigmund Freud).[10]
Natürlich gibt es viele Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Oft wird das Bewusstsein des eigenen Nichtwissens gerade mit besonderer Weisheit gleichgesetzt (Sokrates, Cusanus, Whitehead). Nicht ganz so leicht fallen uns Dinge ein, die wir nicht wissen, aber bei denen uns das Wissen über unser Nichtwissen fehlt. Rumsfeld meinte 2002 mit “unbekanntem Unwissen” wohl allgemeine Gefahren, die man nicht im Blick hat und überhaupt nicht erwartet. Weitere Kandidaten für unknown unknowns sind Dinge, die begrifflich überhaupt nicht fassbar sind, die jenseits der Vorstellungskraft liegen, die noch nicht gedacht oder vorgestellt wurden, mit denen man sich noch nicht befasst oder auf die man seine Aufmerksamkeit noch nicht gerichtet hat. Mir scheinen allerdings Aussagen, an die man einfach noch nie gedacht hat, nicht wirklich zum unbekannten Unwissen zu gehören. So habe ich – bis jetzt – noch nie daran gedacht, dass 178 + 35 = 213 ist, doch könnte man sagen, ich habe es (zumindest implizit) schon lange gewusst. Ich habe auch – bis jetzt – noch nie daran gedacht, dass die Wurzel von 37249 die Zahl 193 ist. Wenn man wirklich sagen möchte, dass ich das nicht gewusst habe, dann war das wohl ein Nichtwissen, das mir bewusst war. Die besten Beispiele für unbekanntes Nichtwissen stellen meines Erachtens die aktuellen eigenen Irrtümer dar. Man überlegt sich leicht, dass man über diese gar kein Wissen haben kann: “Ich weiß, dass ich mich über p irre” heißt ja “Ich weiß, dass ich glaube, dass p, und dass p falsch ist.”[11] Das impliziert, dass ich einerseits glaube, dass p, und andererseits weiß, dass nicht-p, folglich auch glaube, dass nicht p. Wir können aber nicht zugleich glauben, dass p und dass nicht p.[12] Also kann man hier nicht sagen: “Ich weiß, dass ich nicht weiß, dass p.”[13]
Welche der vier Kategorien braucht man für die Anwendung eines argumentum ad ignorantiam? Die Kategorie der known unknowns, des bewussten Nichtwissens. Der Inhalt der (ersten) Prämisse des Arguments besagt gerade, dass man etwas nicht weiß. Das Argument kommt nur dann erfolgreich vom Boden, wenn man Kenntnis vom eigenen Nichtwissen hat.
4. Beispiele für asymmetrische Schlussweisen im Handeln
Das AAI hat, wie gesagt, eine schlechte Presse, denn es kann offenbar in unerwünschter Weise missbraucht werden. Denken Sie an die Galilei-Episode oder, noch näher liegend, an Beispiele wie “Noch niemand hat bewiesen, dass Masken nützen, also nützen sie nichts.” Das allein schon macht klar, dass die Anwendung des AAI als universelles Schema schichtweg inakzeptabel ist.
Dass es jedoch Formen des AAI gibt, die in vielen Kontexten sogar systematisch erfolgreich angewendet werden können, sollen (zunächst) die folgenden praxisorientierten Beispiele veranschaulichen.
- Vor dem Strafgericht gilt in zivilisierten Staaten die Präsumtion der Unschuld des Angeklagten: Wem keine Schuld nachgewiesen werden kann, der gilt als unschuldig. Diese Regel wurde im römischen Recht durch Antonius Pius (86‒161 n. Chr.) eingeführt, ist z.B. auch im 13. Jahrhundert nachweisbar (Jean Lemoine, 1250‒1313, französischer Kardinal) und steht in Art. 11 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948.[14] Nur in ganz eng umgrenzten Ausnahmefällen, etwa bei Verdacht auf terroristische Absichten oder auf sexuelle Übergriffe (“zero tolerance“), kommt eine Schuldvermutung in Frage – und wird doch immer problematisch bleiben.
- Das von den Vereinten Nationen 1992 formulierte Vorsorgeprinzip (precautionary principle) ist ein Prinzip der Umwelt- und Gesundheitspolitik. Es lautet: “Angesichts der Gefahr irreversibler Umweltschäden soll ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewißheit [dass solche Schäden tatsächlich entstehen, HR] nicht als Entschuldigung dafür dienen, [präventive, einschränkende, HR] Maßnahmen hinauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt sind.” In Europa wird das Vorsorgeprinzip bevorzugt, in Nordamerika ist umgekehrt das sog. “risk-based principle“[15] stark, welches den Nachweis der Schädlichkeit verlangt, um die Einführung neuer Produkte und Verfahren verbieten zu können.
- Unser alltägliches kognitives Leben und unser Umgang in der Gesellschaft sind weitgehend von naturwüchsigem Vertrauen auf unsere Wahrnehmung und auf das Zeugnis anderer geprägt. Wenn keine Information dagegen spricht, gehen wir davon aus, dass unsere Sinne und unsere Mitmenschen uns nicht betrügen. Wenn jedoch bestimmte, außergewöhnliche Umstände vorliegen – aber auch nur dann –, kann eine skeptische oder misstrauische Haltung angezeigt sein.
In diesen Beispielen wird die Abwesenheit von Nachweisen für strafrechtliche Schuld, gesundheitliche Unschädlichkeit bzw. zweifelhafte Umstände als Prämisse verwendet, um davon auszugehen, dass es keine Schuld, keine Unschädlichkeit bzw. keinen Betruggibt. Sofern solche Nachweise jedoch vorliegen, hat man Wissen für das Gegenteil erworben.
5. Wenn das AAI auch kein Fehlschluss ist, so ist es doch kein normales Schlussschema
Ist das AAI nun ein Fehlschluss oder nicht? Schlussschemata im Sinne einer üblichen Logik haben unter anderem zwei wichtige Eigenschaften: Sie sind schematisch (d.h. aus strukturellen und nicht aus inhaltlichen Gründen gültig) und sie führen von wahren Prämissen zu wahren Konklusionen, bei tatsächlicher Anwendung auch von (zumindest hypothetisch) für wahr gehaltenen Prämissen zu für wahr gehaltenen Konklusionen. Das AAI hat keine dieser beiden Eigenschaften.
5.1. Das argumentum ad ignorantiam ist asymmetrisch und also nicht schematisch
Die soeben genannten Prinzipien – Unschulds- und Schuldvermutung, Vorsorge und risikobasiertes Prinzip, allgemeines Vertrauen und allgemeines Misstrauen – sind Instanziierungen des AAI. In beide Richtungen gleichzeitig instanziiert, würde das AAI unmittelbar Widersprüche erzeugen. Es wäre offenbar inkohärent oder unmöglich, gleichzeitig die Unschuldsvermutung und die Schuldvermutung in Anschlag zu bringen, gleichzeitig dem Vorsorgeprinzip und dem risikobasierten Prinzip anzuhängen oder gleichzeitig vertrauensvoll und misstrauisch zu sein. Dies unterstreicht noch einmal, dass das AAI keine strukturelle (schematische, durch Substitution verallgemeinerbare) Schlussregel ist und in diesem Sinn gar nicht als logische Schlussregel aufgefasst werden kann. Mit konkreten Inhalten gefüllt, sind seine Instanziierungen materiale, inhaltliche Schlussregeln, von denen manche Geltung beanspruchen können, andere nicht.
Bildlich gesprochen, ist das AAI kein zweischneidiges Schwert, sondern wie ein gewöhnliches Küchenmesser nur in einer Richtung benutzbar. Mit welcher Schneide soll das Messer schneiden, und wo soll es stumpf sein? Das kann nur aus inhaltlichen, nicht aus formal-logischen Gründen bestimmt werden. Man muss also – wie in den drei Beispielen – bestimmen, welche Partei die Beweislast tragen und für Wissen sorgen muss. Die andere Partei darf dann so tun, als sei die Abwesenheit von Evidenz schon Evidenz für die Abwesenheit, genauer: als sei die Abwesenheit von Evidenz für die Falschheit von p Evidenz für die Abwesenheit der Falschheit von p, also Evidenz für die Wahrheit von p.
Die Anwendung des AAI macht also Vorannahmen (defaults), ist voreingenommen(biased), manifestiert Vorurteile(prejudices). Während die Rede von Vorannahmen noch unverdächtig ist, sind “Voreingenommenheit” und “Vorurteile” eindeutig negativ besetzt. Vorurteile sind oft mit starken ablehnenden Emotionen verbunden und führen nicht selten zu verwerflichen Handlungen. Weiter sind Vorurteile zu kritisieren, wenn sie hartnäckig, starr und eingefahren sind. Auch das kommt oft vor. Semantisch beinhaltet das Wort “Vorurteil” diese Elemente aber nicht. Die Hartnäckigkeit kann mitgedacht werden, wenn Vorurteile mit Gerichtsurteilen analogisiert werden: Eine Sache wird abgeschlossen, ein Schlussstrich wird gezogen, das Urteil wird gefällt, und sein Inhalt ist zu akzeptieren. In erster Linie sind Vorurteile – als Vor-Urteile – von der Wortbedeutung her aber Urteile, die “vorzeitig” oder “vor alle relevanten Informationen auf dem Tisch liegen” gefällt werden.
Vorurteile beinhalten oft Verurteilungen, aber sie sind nicht immer negativ.[16] Vorurteile können auch positiv sein, und zwar in doppelter Weise. Erstens inhaltlich: “Italiener kochen gut”, “Schweizer sind pünktlich”, “Amerikaner sind zupackend”. Allgemeiner ist das gegenseitige Vertrauen, auf das sich viele Gemeinschafen und Gesellschaften wesentlich stützen, so etwas wie ein generalisiertes positives Vorurteil, dass die je anderen schon gute Eigenschaften haben und gute Handlungsweisen an den Tag legen werden. Vorurteile sind aber auch auf der Metaebene betrachtet etwas Positives: Wir brauchen Vor-Urteile, denn wir kommen ohne sie in unserem alltäglichen Denken und Handeln nicht aus. Die Versorgung mit Urteilen, die echtes, vollwertiges Wissen darstellen, ist einfach zu dünn.[17]
Es gibt auch Vorurteile, die per se weder negativ noch positiv sind. Ein sehr allgemeines und wichtiges Vorurteil lautet: “Alles ist normal (es sei denn, ich höre oder sehe oder erfahre etwas anderes).” Es formuliert auf neutrale Weise allerlei Erwartungen, Standardannahmen, Präsumtionen, defaults usw. In vielen Einzelfällen wirkt es unbewusst, es kann aber auch bewusste Berücksichtigung finden. Die Bewusstheit wird, so kann man spekulieren, typischerweise geweckt, wenn Evidenz auftaucht, aufgrund derer ein Vorurteil zu revidieren oder ganz zu beseitigen ist.
Warum wird der Begriff des Vorurteils fast überall in negativer Weise gebraucht? Neben den mit Vorurteilen verbundenen negativen Emotionen und schlechten Handlungen ist hier wohl auch ihre Hartnäckigkeit und Unausrottbarkeit zu nennen. Vorurteile bestehen häufig auch dann fort, wenn es längst starke Evidenz für ihre Falschheit gibt. Wie schon angedeutet, ist dies – in meinen Augen – aber eine kontingente Eigenschaft von Vorurteilen. Vorurteile erscheinen in einem freundlicheren Lichte und können akzeptiert werden, wenn sie (i) keine schlechten Emotionen und Handlungen im Gefolge haben und (ii) bereitwillig aufgegeben werden, wenn sich Evidenz gegen sie einstellt.
5.2. Das AAI führt nicht vom Wissen zum Wissen und noch nicht einmal vom Glauben zum Glauben
Über die Qualität der Konklusion ist bisher noch nichts gesagt. Bei gewöhnlichen logischen Schlüssen stellt die Konklusion Wissen dar, wenn die Prämissen gewusst werden. Stellt auch die Konklusion des AAI Wissen dar? Wird im AAI also Wissen aus (Wissen über) Nichtwissen erzeugt?
Das wäre sicherlich zu viel behauptet. Die praktischen Beispiele zeigen das. Ein Freispruch aus Mangel an Beweisen bedeutet nicht, dass irgendjemand weiß, dass der Angeklagte unschuldig ist. Wenn der Nachweis der Unschädlichkeit eines neuen Produkts noch aussteht, heißt das nicht, dass man weiß, dass es schädlich ist. Unser Vertrauen auf die Integrität anderer Menschen impliziert nicht, dass wir wissen, dass diese integer sind. Es stellt sich nicht nur kein Wissen ein, sondern nicht einmal eine vollwertige Überzeugung.
Wenn “schlussfolgern” bedeuten soll, dass sich das Fürwahrhalten der Prämisse auf das Fürwahrhalten der Konklusion überträgt, dann wird in vielen Anwendungsfällen des AAI nicht wirklich geschlussfolgert. Wie gesagt, bei Mangel an Beweisen ist durchaus nicht klar, ob der Angeklagte tatsächlich unschuldig ist; er gilt nur als unschuldig oder wird als unschuldig behandelt.
Statt Wissen und Überzeugung, dass die Konklusion wahr ist (“der Angeklagte ist unschuldig”, “das Produkt ist schädlich”, “der Nachbar ist anständig”), gibt es aber häufig etwas Schwächeres: eine Meinung, eine Vermutung, eine Erwartung oder auch nur einen Verdacht, dass die Konklusion wahr ist. Eine noch bessere, allgemeiner gültige Charakterisierung der Einstellung gegenüber der Konklusion eines AAI scheint mir die Formulierung zu sein, dass wir davon ausgehen, dass p, oder p akzeptieren – mit oder ohne volle Überzeugung. Genauer gesagt, gehen wir bei unseren weiteren Überlegungen oder Handlungen davon aus bzw. akzeptieren, dass p. Wir überlegen und handeln so, als ob die entsprechende Proposition wahr wäre: Der Angeklagte wird frei gelassen, das Produkt wird einstweilen nicht eingeführt, und wir freuen uns, wenn unsere Nachbarn unsere Postpakete entgegennehmen.
Zusammengefasst: Eine richtige Lesart des AAI ist nicht
Weil ich nicht weiß, dass nicht p, deshalb weiß ich/glaube ich, dass p.
sondern
Weil ich nicht weiß, dass nicht p, deshalb gehe ich (bei meinen folgenden Überlegungen und Handlungen) davon aus, dass p.
6. Anfechtbares Schlussfolgern
Das Schlussfolgern vermittels des AAI hat zwei gleich wichtige Teile: das Springen auf eine Konklusion (die dann oft aber keine Überzeugung ist) und die jederzeit vorhandene Bereitschaft, diese Konklusion wieder zurück zu ziehen.[18] Anders als in den klassischen Gebrauchsweisen der Logik ist die Konklusion des AAI durch neue, “widrige” Evidenz prinzipiell anfechtbar, revidierbar, “schlagbar” (defeasible). Die Untersuchung solcher Argumentationen ist Teil eines größeren Forschungsgebiets, das oft nur negativ als nichtmonotones Schließen bezeichnet wird.
Der Anstoß dazu kam – und das könnte Philosophen und Philosophinnen ein bisschen peinlich sein – nicht aus der Philosophie, sondern aus der Künstliche-Intelligenz-Forschung. Das geschah zu den Zeiten, als “Künstliche Intelligenz” noch logik-basiert und harmlos war und nicht Kühlschränke, Rasenmäher, Fernseher, Autos zu kontrollieren begann. Das Geburtsjahr des nichtmonotonen Schließens lässt sich ziemlich genau auf 1980 datieren. In diesem Jahr erschien ein Themenheft der Zeitschrift Artificial Intelligence, in der gleich drei Vorschläge ausgearbeitet waren, wie man Schlüsse von der Art des AAI in ein sinnvolles logisches System bringen könnte.
Zu erwähnen ist hier die Autoepistemische Logik von Robert Moore,[19] in der es einen Modaloperator gibt, welcher dazu da ist, inhaltlich gefüllte Aussagen der Form “wenn ich nicht weiß, dass p, dann q” darzustellen. Als langfristig erfolgreicher hat sich der Ansatz der Default logic von Raymond Reiter erwiesen, der einen ganz ähnlichen Inhalt nicht in objektsprachliche Sätze, sondern direkt in die anzuwendenden Schlüsse selbst packt.[20] Eine typische Form ist “wenn p und ich nicht bewiesen habe, dass nicht q, dann q“. Bei diesen sog. Defaults sind p und q nicht schematisch zu lesen, sondern immer inhaltlich gefüllt. Man kann sich vorstellen, dass es schwierig ist, mit solcherart Systemen konstruktive Beweise zu führen. Denn die an einer bestimmten Stelle benutzte Voraussetzung, dass q nicht bewiesen ist, kann ja in einem späteren Stadium des Beweises falsifiziert werden – wenn man dann doch einen Beweis von q hat. Man behilft sich mit der Definition von Fixpunkten, welche eine als Menge von Defaults repräsentierte “Wissensbasis” erweitern. Es zeigte sich schnell, dass es einerseits nicht für jede Wissensbasis solche Fixpunkte gibt, dass andererseits nicht selten mehrere Fixpunkte existieren. Neben der in den Fixpunkten kodierten kohärentistischen Idee des Zusammenpassens aller Elemente muss noch die Idee der Fundiertheit der Fixpunkte beachtet werden.
Viele alternative Systeme für nichtmonotones Schließen wurden inzwischen entwickelt, jedes mit Vor- und mit Nachteilen. Wie häufig in der Philosophie und in der Logik, mussten die schönen einfachen Ideen so lange variiert und verfeinert werden, bis es keinen Konsens mehr gab, welche Ansätze nach welchen Maßstäben denn nun die besten und richtigsten seien. Das muss uns an dieser Stelle aber nicht kümmern. Wichtig ist, dass die Idee des AAI sich als im Prinzip sinnvoll konkretisierbar erwiesen hat und auf dem Umweg über die KI-Forschung rehabilitiert wurde.
7. Schluss: Zum Umgang mit dem Nichtwissen
Zunächst einmal stellen wir fest, was das argumentum ad ignorantiam nicht ist. Es ist kein Appell an das Nichtwissen, sondern ein Schluss aus dem Nichtwissen. Es ist keine Zauberei, die aus Nichtwissen Wissen erzeugt. Es ist kein Argument, das uns von wahren, gewussten oder geglaubten Prämissen zu einer wahren, gewussten bzw. geglaubten Konklusion führt. Und es ist kein allgemeines, allgemein-gültiges Schema, das unabhängig von Inhalten zur Anwendung kommen kann.
Manche Instanzen des argumentum ad ignorantiam sind schlechte Instanzen (man denke an Galilei und die Corona-Masken), manche Instanzen des Arguments sind gute Instanzen (man denke an Unschuld, Schaden und Vertrauen). Können wir etwas darüber sagen, wonach es sich richtet, welche Instanzen gute Instanzen sind? In den praktischen Beispielen oben sind praktische Gründe wie die Rationalität oder Moralität von Handlungen ausschlaggebend. Das ist eine eigene Art von Begründung.
Mögliche Antworten in rein theoretischen/kognitiven Anwendungen könnten lauten: (a) die Rolle der schlussfolgernden Personen ist wichtig: Wenn sie besonders involviert und für den fraglichen Sachverhalt – für p – kompetent sind (etwa als nahe Freunde oder Verwandte, Experten oder geschäftlich Zuständige), dann darf man mit Gründen davon ausgehen, dass sie es wissen würden, wenn die Konklusion falsch wäre; und (b) die Natur des in Rede stehenden Sachverhalts – p – ist relevant: wenn er sehr außergewöhnlich und sensationell ist, dann dürfen auch nicht involvierte Personen davon ausgehen, dass sie wüssten, wenn p der Fall wäre (Bsp. Flugzeugabsturz). Unter diesen Umständen könnte man zuversichtlich sagen: “Wenn p wahr wäre, dann würde ich wissen, dass p.”
Bleibt nicht trotzdem ein Vorwurf? Müssen sich die Befürworter des AAI nicht sagen lassen: “Da tritt doch das Vorurteil an die Stelle des Wissens!” Das stimmt schon. Aber genau diese Stelle, die Stelle des Wissens, ist bei vielen Fragen immer schon vakant gewesen. John Locke, der oben schon als Erfinder des Namens “argumentum ad ignorantiam” erwähnt wurde, hat das die “dunkle Seite” unseres Geistes genannt:
“Da unser Wissen […] ziemlich beschränkt ist, werden wir vielleicht über den jetzigen Zustand unseres Geistes etwas Licht erhalten, wenn wir einmal nach der dunklen Seite blicken und unsere Unwissenheit überschauen. Diese ist nämlich unendlich viel größer als unser Wissen.”[21]
Zum Umgang mit unserer “unendlich großen” Unwissenheit, so habe ich versucht zu zeigen, sollte gehören, auch niedrigere Formen der Einstellung als Wissen wert zu schätzen: Glauben und Weniger-als-Glauben, Erwartungen, Vermutungen, Defaults, Hintergrund-, Normal-, Vor- oder Standardannahmen. Oder einfach ein Davon-ausgehen-dass, welches nicht unbedingt von einem Gefühl des Fürwahrhaltens begleitet sein muss.
Komplementär hierzu muss eine zweite Komponente unseres Umgangs mit unserer epistemischen (Not-)Situation betont werden: Bleibe gegenüber allen Deinen Schlussfolgerungen kritisch! Dies gilt in besonderem Maße für das argumentum ad ignorantiam. Aber bei strengen Maßstäben betrachtet, ist fast jedes Glauben, fast jede Überzeugung vorläufig, anfechtbar und revisionsanfällig. Denn wir wissen nur von eher wenigen und eher wenig interessanten Dingen (endgültig und sicher), dass wir sie wissen.[22]
Hans Rott ist Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Regensburg. Er arbeitet zu Themen der philosophischen Logik, Erkenntnistheorie und Sprachphilosophie.
Literatur
Allport, Gordon W. (1954), The Nature of Prejudice, Reading, MA: Addison-Wesley. Dt. Die Natur des Vorurteils, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1971.
Bach, Kent (1984), “Default reasoning: Jumping to conclusions and knowing when to think twice”, Pacific Philosophical Quarterly 65, 37‒58.
Church, Alonzo (2009), “Referee reports on Fitch’s ‘A definition of value'”, in Joe Salerno (ed.), New Essays on the Knowability Paradox, Oxford: Oxford University Press, S. 13‒20.
Copi, Irving, und Carl Cohen (1990), Introduction to Logic, 8. Auflage, New York: Macmillan.
Fitch, Frederic (1963), “A logical analysis of some value concepts”, Journal of Symbolic Logic 28, 135‒142.
Freud, Sigmund (1927), Die Zukunft einer Illusion, Leipzig: Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Zitiert nach S.F., Werke aus den Jahren 1925‒1931, Gesammelte Werke, Bd. 14, Frankfurt a.M.: Fischer/London: Imago 1948, S. 323‒380.
Gadamer, Hans-Georg (1972), Wahrheit und Methode, 3., erw. Auflage, Tübingen: Mohr.
Galilei, Galileo (1890‒1909), Le Opere di Galileo Galilei, 20 Bde., ed. Antonio Favaro, Florenz: Barbèra.
Hamblin, Charles A. (1970). Fallacies, London: Methuen.
Horgan, John (1992), “The new challenges”, Scientific American 267(6), 16‒23.
Kahneman, Daniel (2011), Thinking, Fast and Slow, New York: Farrar, Straus and Giroux.
Krabbe, Erik C. W. (1995), “Appeal to ignorance”, in H. V. Hansen und R. C. Pinto (eds.), Fallacies, University Park: Penn State University Press, S. 251‒264.
Kraft, Tim, und Hans Rott (2019), “Was ist Nichtwissen?”, in: Gunnar Duttge und Christian Lenk (eds.), Das sogenannte Recht auf Nichtwissen: Normatives Fundament und anwendungspraktische Geltungskraft, Münster: Mentis, S. 21‒48.
Locke, John (1690), An Essay Concerning Human Understanding, London: Basset. Dt. Ausgabe: Versuch über den menschlichen Verstand, 4. Auflage in zwei Bänden, Hamburg: Meiner 1988.
Moore, Robert C. (1984), “Possible-world semantics for autoepistemic logic”, Non-Monotonic Reasoning Workshop, New Paltz/NY, S. 344‒354.
― (1985), “Semantical considerations on nonmonotonic logic”, Artificial Intelligence 25, 75‒94.
Morris, Errol (2014), “The certainty of Donald Rumsfeld”, The New York Times, 4 Teile, 25.‒28. März 2014.
Reiter, Raymond (1980), “A logic for default reasoning”, Artificial Intelligence 13, 81‒132.
Rumsfeld, Donald (2011), “Known and unknown: Author’s note”, in D.R., Known and Unknown: A Memoir, New York: Sentinel, S. xiii‒xvi.
van Eemeren, Frans H., Rob Grootendorst und Francisca Snoeck Henkemans (2002), Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Walton, Douglas N. (1996), Arguments from Ignorance, University Park, PA: Pennsylvania State University Press.
― (1999), “The appeal to ignorance, or argumentum ad ignorantiam”, Argumentation 13, 367‒377.
―, Christopher Reed und Fabrizio Macagno, Argumentation Schemes, Cambridge: Cambridge University Press 2008.
Žižek, Slavoj (2005), “The empty wheelbarrow”, The Guardian, London, 19 February 2005.
[1] Das deutsche Robert-Koch-Institut veröffentlichte übrigens von Januar 2020 an eine differenziertere Stellungnahme: “Dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit das eigene Risiko einer Ansteckung signifikant verringert, ist nicht wissenschaftlich belegt (kein Eigenschutz).” Dieser Hinweis auf den nicht nachgewiesenen Schutz der maskentragenden Person wurde allerdings weitgehend ebenfalls als Argument für die Ablehnung des Tragens von Masken verstanden.
[2] Nach Perrypedia, einem unabhängigen Nachschlagewerke-Projekt zu diesen Serien. SENECA wurde offensichtlich nach dem römischen Philosophen, Naturforscher und Staatsmann Lucius Annaeus Seneca (ca. 1‒65 n.Chr.) benannt.
[3] Diese Ansicht wird zwar in zahllosen fachwissenschaftlichen und populären Darstellungen vertreten, aber natürlich bewerten das nicht alle Autoren so. Zu den Verteidigern des AAI zumindest in manchen Anwendungssituationen gehören Krabbe (1995) und Walton (1996, 1999). Dagegen argumentieren van Eemeren, Grootendorst und Snoeck Henkemans (2002).
[4] John Locke (1690, dt. 1988, zweiter Band S. 389f).
[5] Copi and Cohen (1990, S. 93, meine Übersetzung).
[6] Diese Episode ist nachzuvollziehen in zwei Briefen, von Lodovico delle Colombe an Clavius am 27. Mai 1611 und von Galilei an Gallanzone Gallanzoni am 16. Juli 1611 (Galilei 1890‒1909, Bd. XI, 1901, S. 118 und 143).
[7] Vgl. Walton, Reed und Macagno (2008, S. 327), die das AAI ähnlich fassen:

[8] Viele Darstellungen des Arguments verwenden die Formulierung “man weiß nicht, dass …”. Man beachte, dass aus der 1.-Person-Perspektive, also “von innen”, Wissen oft nicht vom Glauben (Überzeugtsein, Fürwahrhalten) zu unterscheiden ist. “Das wüsste ich aber” erscheint also mehr oder weniger gleichwertig mit “das würde ich dann aber glauben”. Aus der Außenperspektive der 3. Person stellt sich dies natürlich ganz anders dar, hier werden “wissen” und “glauben” sehr deutlich unterschieden.
[9] Seltener auch:

[10] Vgl. die ausführliche Diskussion verschiedener Typen des Nichtwissens in Kraft und Rott (2019).
[11] Oder umgekehrt “Ich weiß, dass ich glaube, dass nicht p, und dass p wahr ist”; dieser Fall ist analog.
[12] Im Beweis der Wissbarkeitsparadoxie von Church (2009; ursprünglich 1945) und Fitch (1963) wird auf der Grundlage sehr schwacher (also voraussetzungsarmer) epistemologischer Prinzipien gezeigt wird, dass “p und ich weiß nicht, dass p” nicht gewusst werden kann. ‒ In der epistemischen Logik als einer Form der Modallogik postulieren die Axiome, welche für die sehr populären Systeme S4 und S5 charakteristisch sind, eine perfekte Introspektion bezüglich des eigenen Wissens bzw. bezüglich des eigenen Nichtwissens. Die erstere ist umstritten. Die zweite ist noch viel umstrittener und erscheint mir als im Allgemeinen klarerweise ungültig; allenfalls kann man sie in bestimmten Kontexten als gültig ansetzen.
[13] Das gilt auch für andere Fälle von unknown unknowns, allerdings aus anderen Gründen.
[14] Bekannte symmetriebrechende Formulierungen sind “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat“, “in dubio pro reo” und”presumed innocent until proven guilty“.
[15] Auch “sound science principle“, auf Deutsch manchmal “Wissenschaftsprinzip” genannt – eine ärgerliche, klar verfehlte Bezeichnung.
[16] Diese weite Lesart widerspricht der klassischen sozialpsychologischen Definition von Allport (1954/1971), wonach ein Vorurteil eine “ablehnende oder feindselige Haltung gegen eine Person, die zu einer Gruppe gehört, [ist,] einfach deswegen, weil sie zu dieser Gruppe gehört und deswegen dieselben zu beanstandenden Eigenschaften haben soll, die man dieser Gruppe zuschreibt.” Vorurteile wären demnach vor allem dem affektiven Bereich zuzurechnen; der entsprechende sozialpsychologische Begriff im kognitiven Bereich ist der des Stereotyps.
[17] Gadamer (1972, S. 254) spricht von der “wesenhaften Vorurteilshaftigkeit alles Verstehens”. Insoweit alles Verstehen auf Vorurteilen beruht, haben diese eine fundamental positiver Funktion.
[18] Vgl. die sehr treffenden Charakterisierung im Aufsatztitel von Bach (1984): “Jumping to conclusions and knowing when to think twice”. Nach Kahneman (2011, Kapitel 7) ist für unser intuitives Denken eine “machine for jumping to conclusions” von entscheidender Bedeutung.
[19] Dieses System kam etwas später, nämlich mit Moore (1984, 1985); es hat den Vorteil einer klaren intendierten Interpretation.
[20] Reiter (1980).
[21] Locke (1690, dt. 1988, zweiter Band S. 205). Ähnlich auch die schöne Metapher von John A. Wheeler (wiedergegeben in Horgan 1992, S. 20): “We live on an island surrounded by a sea of ignorance. As our island of knowledge grows, so does the shore of our ignorance.”
[22] Ich danke einem Auditorium in Münster, den Teilnehmern meines Oberseminars in Regensburg sowie Andrea Klonschinski und Tim Kraft für kritische Diskussionen und hilfreiche Anmerkungen zu früheren Fassungen dieses Beitrags.


