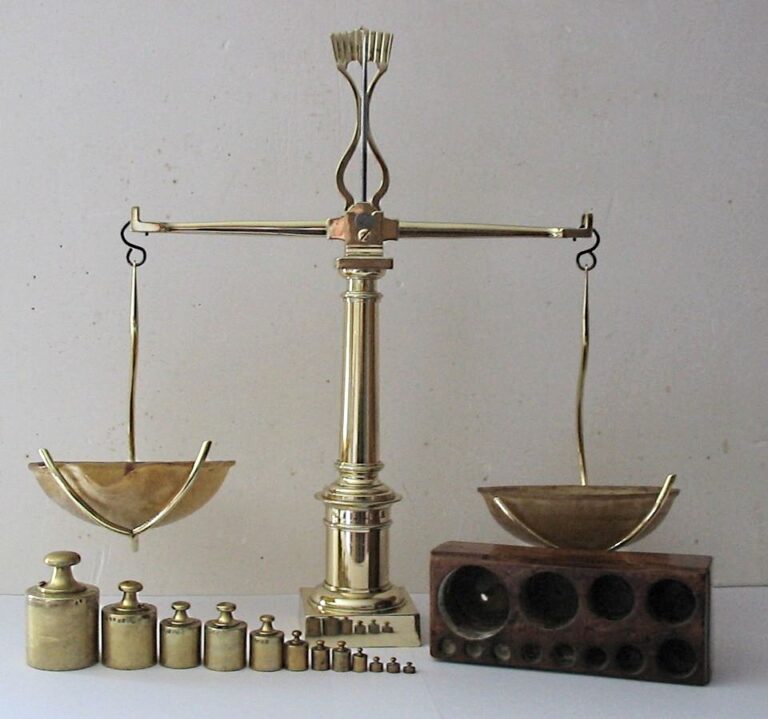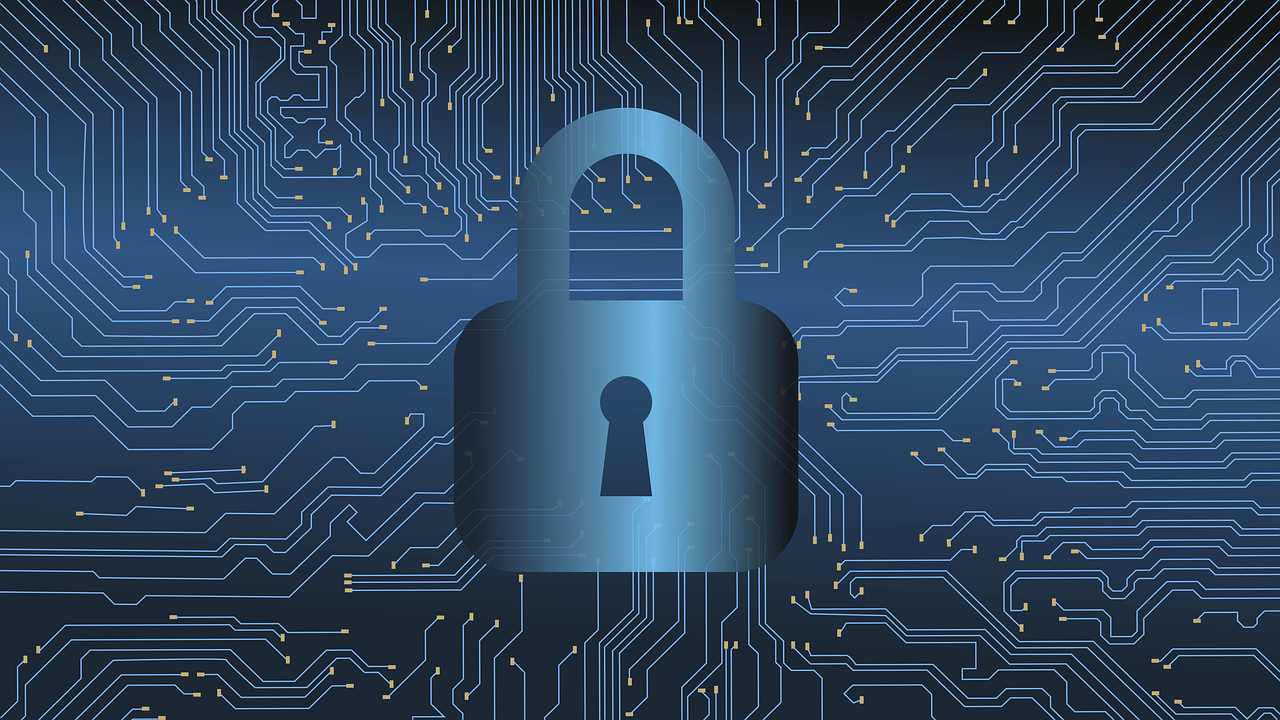
Digitale Privatheit: Herausforderungen zwischen Autonomie, Demokratie und Datenmacht
Von Lea Watzinger (Passau)
Die digitale Welt ist längst keine Parallelwelt mehr. Sie ist Teil unseres Alltags – so selbstverständlich wie Strom, Licht oder Wasser. Doch mit der ständigen Vernetzung stellen sich auch neue Fragen: Was passiert mit den Spuren, die wir im Netz hinterlassen? Wer hat Zugriff auf unsere Bewegungen, unsere Vorlieben, unsere Gedanken? Gibt es überhaupt noch etwas Privates in unserer digitalen Welt?
Historischer und normativer Wert des Privaten
Die Unterscheidung zwischen öffentlicher und privater Sphäre ist bei Weitem nicht neu. Was als privat angesehen wird, unterliegt jedoch schon immer unterschiedlichen Einschätzungen und Bewertungen: Kaum etwas ist überall und über alle Zeiten hinweg privat. In der antiken Philosophie kommt der Unterscheidung von öffentlichem und privatem Tätigsein eine wesentliche Rolle für das Verständnis von Politik zu. Mit der Entwicklung der liberalen Demokratie und der Aufklärung verstärkt sich der Fokus auf die Öffentlichkeit, in der freie und vernünftige Bürger (und Bürgerinnen) die Grundlage des Staates darstellen. Die Privatsphäre wird dabei gedacht als Schutzraum gegenüber der Öffentlichkeit und dem Staat, in dem das Individuum vor ungewolltem Zugriff sicher sein muss. Nur in einem solchen Raum, der keinen Anforderungen von außen unterliegt, können die Bürger:innen ihre individuelle Autonomie entwickeln, also die Fähigkeit, sich selbst Regeln zu geben und Entscheidungen eigenständig zu treffen.
Was heißt „Privat“ – und warum ist das wichtig?
Die Privatsphäre besteht aus Sphären des Lebens, in denen wir etwas verbergen können, wenn wir wollen. Die Philosophin Beate Rössler unterscheidet dabei drei Dimensionen der Privatheit: dezisional, informationell und lokal (Rössler 2001). Alle drei sind sehr wichtig für die Möglichkeit eines gelingenden, selbstbestimmten Lebens.
- Die dezisionale Privatheit bezieht sich darauf, ob ich meine Entscheidungen selbstbestimmt treffen kann, oder mich jemand beeinflussen oder manipulieren will.
- Die informationelle Privatheit betrifft Informationen über mich: Wer weiß was über mich, und liegt es in meiner Hand, diese Informationen zu teilen?
- Die lokale Privatheit umfasst die Unzugänglichkeit von Räumen, z.B. des Zuhauses, an denen ich unbeobachtet sein kann.
Rössler arbeitet als zentrales Kriterium die Zugangskontrolle heraus. Ich muss selbst darüber verfügen können, mit was ich mich befasse und wer (oder was) entsprechend meine Willensbildung beeinflussen soll, wer was über mich wissen darf, oder wer in meine Wohnung eintreten darf. Nur wer Entscheidungen frei trifft, selbst über seine Daten bestimmt, und Räume hat, in denen er oder sie sich zurückziehen kann, kann wirklich selbstbestimmt leben – also verantwortlich handeln, eine eigene Meinung entwickeln und sich selbst treu bleiben.
Soziale Privatheit und Demokratie
Der Privatheit kommt in der Demokratie also eine wesentliche normative Funktion zu. Doch Privatheit ist nicht nur individuell bedeutsam, sondern hat auch gesellschaftliche Funktionen. Sandra Seubert erweitert die liberale Perspektive und begreift Privatheit als gesellschaftlich wertvoll, da sie die Bedingungen für politische Deliberation, Rollenvielfalt und Meinungsbildung schafft (Seubert 2017). Das demokratische Zusammenleben ist maßgeblich geprägt von zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen und privatem Austausch, die Vernetzung mit anderen ermöglichen. Seubert versteht Privatheit daher als soziale Freiheit – und als Voraussetzung gemeinschaftlicher politischer Handlungsfähigkeit. In privaten Räumen schließen wir Bürger:innen uns zusammen, um gemeinsam politisch handeln zu können.
Digitale Transformation: Verschiebung von Macht und Sichtbarkeit
Die digitale Transformation verändert nun unsere gesellschaftlichen Umgangsformen radikal. Was einmal als privat galt, ist heute öffentlich sichtbar – nicht mehr nur gegenüber dem Staat, sondern vor allem gegenüber privaten Unternehmen und anderen, unbekannten Nutzer:innen. Der sogenannte ‚gläserne Mensch‘ wird durchschaubar und das weniger durch staatliche Überwachung als durch eine Mischung aus freiwilliger Datenpreisgabe und Nutzbarmachung von Hintergrunddaten durch Tracking durch digitale Großkonzerne, wie Meta oder Google (Sobala/Watzinger 2019). Diese doppelte Datafizierung des Menschen im Netz, auf Plattformen und in Apps führt zu einer digitalen Entgrenzung: die Unterscheidung von öffentlich und privat verwischt. Der Adressat:innenkreis erweitert sich, oft ohne, dass sich Nutzer:innen dessen vollends bewusst sind. So kommt es nicht nur zu einem Kontrollverlust über den Zugriff auf die eigenen Daten – der potentielle Missbrauch von Daten oder Identitätsdiebstahl können Menschen auch massiv in ihrem Alltag und ihrem Sicherheitsempfinden treffen.
Horizontale und vertikale Transparenz
Die digitale Entgrenzung verläuft einerseits horizontal, also zwischen den Nutzer:innen selbst: Wir sehen im „front-end“ die anderen Nutzer:innen und ihre Profile, genau das macht den Reiz von Social Media aus. Soziale Medien lassen durch gegenseitige Sichtbarkeit und Vernetzung also die Nutzer:innen füreinander transparent erscheinen. Andererseits entsteht auch eine vertikale Transparenz gegenüber Unternehmen und staatlichen Akteuren: im für die Nutzer:innen unsichtbaren „back-end“ akkumulieren Tech-Konzerne etwa große Mengen intimer Datenbestände, deren Kontrolle technisch und politisch komplex ist. Transparenz wird dabei zur Norm: Sie verspricht Kontrolle und Sichtbarkeit, das transparente Individuum verliert jedoch zusehends seine Privatheit.
Zwischen Selbstinszenierung und Datenregime
Digitale Praktiken wie etwa Self-Tracking oder Social Media lassen uns nun anders als früher mit Daten umgehen und über Privatheit denken. Was früher als intime Information galt – etwa Gesundheits- oder Standortdaten – wird mit Hilfe von Apps bewusst geteilt. Die Gründe reichen von sozialem Austausch bis zu individueller Optimierung. Doch darin liegt ein Paradox: Die Freiheit, sich selbst zu inszenieren, mündet nicht selten in einem Verlust der Privatheit – und damit der Autonomie, die doch geschützt werden sollte. Das ist demokratietheoretisch bedenklich. Denn wo Privatheit schwindet, wird das Subjekt zunehmend transparent – und manipulierbar, etwa durch Produkt-, aber eben auch politische Werbung und die Anzeige personalisierter Inhalte, die auf (vermeintliche) Schwächen abzielen. Die digitalen Medien bringen damit nicht nur Chancen für Teilhabe und Kommunikation, sondern auch Risiken für Freiheit und Demokratie mit sich, da wir den Schutz des Privaten benötigen, um freie und autonome Bürger:innen sein zu können.
Gibt es digitale Privatheit ohne Rückzug von Social Media?
Ein zentrales Problem stellt die Kontrolle über die eigenen Daten dar. Nutzer:innen verlieren leicht den Überblick, mit wem sie welche Daten teilen – was auch durch komplexe Geschäftsbedingungen und intransparente Algorithmen verschärft wird. Die Frage ist nicht, ob wir uns vollständig aus der digitalen Welt zurückziehen wollen oder können – das wäre weder realistisch noch wünschenswert. Vielmehr geht es um eine neue Balance: Wie kann Privatheit im digitalen Zeitalter erhalten oder sogar gestärkt werden? Wie können digitale Infrastrukturen Nutzer:innen- und privatheitsfreundlicher gestaltet und genutzt werden?
Rahmenbedingen
Digitale Privatheit muss als umfassende Aufgabe verstanden werden. Dabei sind die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen von zentraler Bedeutung. Die Gesetzgebung bindet Unternehmen und politische Akteur:innen und ist ein Produkt politischer Willensbildung. Mit der umfangreichen Digitalgesetzgebung greift die EU inzwischen weit in den Binnenmarkt ein, um die Grundrechte der Bürger:innen zu schützen (etwa mit dem Artificial Intelligence-Act (AI-Act) oder dem Digital Services Act (DSA)). Die Bürger:innen wiederum müssen digitale Kompetenzen erwerben und ihre digital/privacy literacy vertiefen, im Sinne einer Fähigkeit, digitale Technologien bewusst, kritisch und selbstbestimmt zu nutzen. Wer weiß, welche Daten er oder sie potentiell preisgibt und welche Folgen das haben kann, kann besser entscheiden, was er oder sie teilen möchte. Datenschutzgesetze, ethische Standards für KI und transparente Algorithmen sind keine technischen Details, sondern Fragen der Demokratie und der Freiheit.
Fazit: Steuerbare Digitalität – steuerbare Privatheit
Digitale Privatheit zu erhalten ist nicht nur ein technisches oder individuelles Problem, sondern eine politische Herausforderung. Zwischen horizontaler Transparenz durch Selbstdarstellung und vertikaler Transparenz durch Datenauswertung entstehen neue Ungleichheiten und Machtverhältnisse. Wir müssen daher Privatheit als digitalen Schutzraum nicht gegen, sondern im Einklang mit den Möglichkeiten digitaler Medien neu denken. Nur so lassen sich Autonomie, Demokratie und ein freies gesellschaftliches Miteinander im digitalen 21. Jahrhundert sichern. Eine zeitgemäße Privatheit bedeutet nicht den Rückzug von Social Media. Sie kann auch heißen, bewusst auszuwählen. Denn nur wer über sein eigenes Maß an Sichtbarkeit entscheiden kann, bleibt handlungsfähig – als Mensch und als Bürger:in einer freien Gesellschaft.
Lea Watzinger ist akademische Rätin am Lehrstuhl für Politische Theorie der Universität Passau. Sie forscht an der Schnittstelle von Politischer Philosophie, Theorie und Medienethik und interessiert sich besonders für Fragen der Digitalen Transformation.
Dieser Blogbeitrag erscheint parallel in Kooperation mit dem Blog des Forschungsprojekts “DiversPrivat: Diversitätsgerechter Privatheitsschutz in digitalen Umgebungen”.
Literatur
Rössler, B. (2001). Der Wert des Privaten. Suhrkamp.
Seubert, S. (2017). Das Vermessen kommunikativer Räume: Politische Dimensionen des Privaten und ihre Gefährdungen. Forschungsjournal Soziale Bewegungen, 30(2), 124–133.
Sobala, F. & Watzinger, L. (2019). Alternative Internetanwendungen und was sie anders machen: Über Geschäftsmodelle, Datenverarbeitungsebenen und gesellschaftliche Aspekte. Magazin des Graduiertenkollegs “Privatheit und Digitalisierung”. https://issuu.com/grkprivatheitdigitalisierung/docs/magazin__12__dezember_2019_