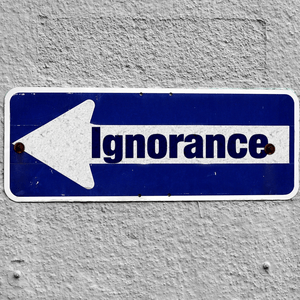
Nicht mehr wissen, wer man ist? Formen des Nicht-Wissens im Kontext der Demenz
von Martina Schmidhuber (Innsbruck & Graz)
Demenz verbindet man mit Vergessen: Vergessen, was man gestern gemacht hat; vergessen, den Herd abzuschalten; vergessen, wie man die Zahnbürste richtig benutzt; schließlich auch das Vergessen der Gesichter der eigenen Kinder und den Namen des Partners. Aber vergessen Menschen mit Demenz auch, wer sie selbst sind? Kommt der Tag, an dem sie nicht mehr um ihre eigene Identität wissen?
Bevor sich der folgende Text dieser Frage widmet, soll zunächst noch eine ganz andere wesentliche Frage in diesem Zusammenhang gestellt werden: Ist es überhaupt hilfreich und sinnvoll, die Diagnose Demenz wissen zu wollen oder ist es klüger, von seinem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch zu machen?
Diagnose Demenz – Präferenz für Nicht-Wissen?
Will man wissen, ob man dement wird? Gemeinhin wird argumentiert, dass eine frühe Diagnose, d.h. eine Diagnose im frühen Stadium, nach den ersten Symptomen, große Vorteile mit sich bringt, v.a. lässt sich der Rest des Lebens planen (z.B. Engedal 2019). Dazu gehört z.B. eine Patientenverfügung zu erstellen. Das impliziert, dass man sich überlegt, welche Behandlungen man im Zustand der schweren Demenz, wenn man sich nicht mehr verbal mitteilen kann, möchte oder nicht mehr möchte, etwa Antibiotika bei einer Lungenentzündung im schweren Stadium. Im frühen Stadium ist es auch noch möglich, ein Testament zu verfassen oder eine Person als Bevollmächtigte für medizinische Entscheidungen zu ernennen; kurz: Man kann seine Angelegenheiten üblicherweise noch regeln, weil die kognitiven Fähigkeiten dafür noch vorhanden sind. Nicht zuletzt kann eine Diagnose auch Erleichterung bringen, weil endlich klar ist, warum diese Gedächtnisprobleme und Erinnerungslücken so massiv auftreten. Ist die Diagnose gestellt, kann zudem krankheitsgerechtes Verhalten der Umgebung erwartet werden (vgl. Füsgen 2001). Es handelt sich dann nicht mehr um ein eigenartiges Verhalten, welches das soziale Umfeld nicht einordnen kann, sondern um eine Krankheit, die das Verhalten verständlich macht und einen angemessenen Umgang mit der Krankheit ermöglicht.
Die Diagnose einer Demenz stellt allerdings eine besondere Herausforderung dar, die mit zwei Risiken verbunden ist: Einerseits besteht die Gefahr, dass Ärzte zu früh Demenz diagnostizieren, weil von verschiedenen Seiten immer wieder postuliert wird, dass die frühe Diagnose für weitere Entscheidungen so wichtig ist, wie oben erläutert. Bedeutsam ist jedoch, zwischen normaler Altersvergesslichkeit, Mild Cognitive Impairment (MCI) und Demenz zu unterscheiden. Eine Demenzdiagnose kann eine starke psychische Belastung für die betroffene Person sein. Wenn die Diagnose fälschlicherweise gestellt wurde, ist diese psychische Belastungssituation völlig unnötig. Das zweite Risiko, das die Diagnosestellung mit sich bringt, ist die schwierige Differentialdiagnose zur Depression. In der Frühphase der Demenz treten häufig depressive Symptome auf und umgekehrt haben Menschen mit schweren depressiven Störungen häufig auch Gedächtnis- und Merkstörungen, wie sie bei einer Demenz vorkommen (vgl. Diehl et al. 2005). Und immer wieder treten Depression und Demenz tatsächlich zusammen auf.
Andererseits kann auch umgekehrt eine zu späte Diagnose problematisch sein. Viele Menschen mit Demenz versuchen ihre Symptome noch längere Zeit zu kaschieren. Besonders gebildete Menschen schaffen es, mit Wortspielen oder Witzen ihrer Vergesslichkeit die Bedeutung zu nehmen. Auch wenn die Angehörigen bereits merken, dass sich die betroffene Person verändert hat, dauert es meist noch einige Zeit, bis sie erkennen, dass es sich um eine Demenz handeln könnte und einen Arztbesuch zur Abklärung als notwendig erachten. Die späte Arztkonsultierung kann jedoch zur Folge haben, dass die Erkrankung dann schon weiter fortgeschritten ist, d.h. dass sich der Betroffene nicht mehr in der ganz frühen Erkrankungsphase befindet und deshalb möglicherweise gewisse Vorausplanungen aufgrund der eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten nicht mehr möglich sind (vgl. Schmidhuber/Gräßel 2018). Die Diagnose ist für viele Personen anfangs ein Schock, selbst wenn schon die Vermutung im Raum stand. Gedanken an Suizid bis hin zur Durchführung des Suizids sind keine Seltenheit, wie prominente Beispiele, z.B. Gunter Sachs, tragischerweise belegen. Immerhin wird mit der Erkrankung der fortschreitende Verlust der Selbstkontrolle und die zunehmende Abhängigkeit von anderen in Verbindung gebracht, auch die nicht unberechtigte Angst vor Stigmatisierung besteht häufig. Da man Demenz zudem nach wie vor nicht heilen, sondern lediglich die Symptome medikamentös und nicht-medikamentös lindern kann, stellt sich die berechtigte Frage, ob es besser ist, nichts von der Demenz zu wissen. Wäre es nicht besser und der Lebensqualität zuträglich, nichts darüber zu wissen, vielleicht sich selbst etwas vorzumachen und nach dem Übertreten der „gnädigen Schwelle“ – ab der man vergisst, dass man vergisst –, ein unbekümmertes Leben zu führen? Das mag für manche Menschen eine Option sein. Neben dem Recht auf Wissen steht ein gleichrangiges Recht auf Nicht-Wissen (vgl. Schöne-Seifert 2007). Niemand kann gezwungen werden, seine kognitiven Defizite abklären und diagnostizieren zu lassen. Das medizinische Personal darf deshalb nicht ungefragt und ungebeten Diagnosen stellen und mitteilen. Wenn man die Symptome aber massiv im täglichen Leben wahrnimmt, das Zusammenleben mit den Angehörigen immer schwieriger wird und man sich im Alltag immer schwerer allein zurechtfindet, wird es nahezu unmöglich, vor sich und anderen die Symptome zu leugnen und weiterhin zu kaschieren. Der Verdacht, es könnte eine Demenz sein, drängt sich früher oder später unbarmherzig auf.
Es scheint also eine Frage der Persönlichkeit sein, wie man mit der Erkrankung umgeht: Dem einen hilft es, planen zu können, Bescheid zu wissen, warum er diese und jene Defizite hat. Dem anderen tut es gut, sich so zu verhalten, als wäre nichts und von seinem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch zu machen. Beides ist zu akzeptieren und bedeutet, dass der Arzt sensibel abzuklären hat, ob der Betroffene informiert werden möchte.
Bedeutet Demenz, nicht mehr zu wissen, wer man ist?
Unabhängig davon, ob eine Person die Diagnose Demenz erfahren möchte oder nicht, stellt sich die Frage, ob sie eines Tages vergessen wird, wer sie selbst ist. In diesem Zusammenhang wird von einem Verlust der personalen Identität bei Demenz gesprochen. Allein dies zeigt, wie sehr wir die Identität einer Person ganz im Sinne John Lockes mit ihren kognitiven Fähigkeiten und dem Gedächtnis in Verbindung bringen. Dabei übersehen wir häufig, dass Vergessen wesentlich für Erinnern ist. Uns an alles zu erinnern, das wir je erlebt, gelesen und gehört haben, wäre eine Überforderung und würde uns handlungsunfähig machen.
Freilich, wenn man nicht mehr weiß, was am Vortag geschehen ist und wer die freundliche Person ist, die einem gegenübersitzt – selbst wenn es die eigene Tochter ist –, fällt es schwer, dies nicht mit einem Verlust der personalen Identität in Verbindung zu bringen. Dennoch scheint es mehr zu geben, als das Gedächtnis, das eine Person zu derjenigen macht, die sie ist. Es soll deshalb anhand des Leibgedächtnisses (vgl. Jungert 2018) und der narrativen Identität (vgl. Schechtman 2007 und 2018) gezeigt werden, dass sich Identität und Demenz nicht ausschließen.
Im Leibgedächtnis sind Situationen und Handlungen manifestiert, ohne dass einzelne sichtbar wären. In der Gedächtnisforschung spricht man vom impliziten Gedächtnis; es ist das Unbewusste, das Verfestigte. Das implizite Gedächtnis ist häufig auch noch im fortgeschrittenen Stadium der Demenz funktionsfähig. Das zeigt sich etwa, wenn eine Frau im fortgeschrittenen Stadium der Demenz Kartoffeln in einer Geschwindigkeit schält, in der man es ihr nicht mehr zugetraut hätte. Sie kann es aber, weil sie es ihr Leben lang gemacht hat und nicht darüber nachdenken muss. Das implizite Gedächtnis zeigt sich auch, wenn Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz alte Lieder in- und auswendig können und mitsingen. „Eingespielte Bewegungsabläufe, wiederkehrende Wahrnehmungsgestalten, Handlungs- und Interaktionsformen sind zu einem impliziten leiblichen Kennen oder Können geworden.“ (Fuchs 2008) Meist wirken die Personen mit Demenz in solchen Situationen sehr zufrieden und ausgeglichen, sie scheinen in diesen Momenten sehr genau zu wissen oder vielleicht mehr zu spüren, wer sie sind.
Versteht man Identität im Locke‘schen Sinne – sich zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten als dieselbe Person denken zu können – kann man sich von der Idee von personaler Identität bei Demenz gleich verabschieden. Zieht man allerdings den narrativen Ansatz von Marya Schechtman in Betracht, zeigt sich, dass die ganze Biographie beziehungsweise die individuelle Lebensgeschichte einer Person ihre Identität ausmacht (vgl. Schechtman 2007). Das bedeutet, dass dann auch die Demenz ein Teil der Lebensgeschichte und somit der Identität ist. Identität wird im Laufe des Lebens gebildet, indem eine je individuelle Lebensgeschichte erzählt wird. Wenn Menschen mit Demenz ihre Lebensgeschichte selbst nicht mehr erzählen können, weil nur noch ihr Leibgedächtnis funktionsfähig ist, sind es vor allem andere Menschen im Umfeld, die einen wesentlichen Beitrag zur Weitererzählung der Geschichte beitragen. Das trifft aber nicht nur für den Zustand der Demenz zu, sondern für unser ganzes Leben. Nur nehmen wir als gesunde Menschen weniger stark wahr, wie konstitutiv andere für das Erzählen unserer Lebensgeschichte sind. Schechtman spricht davon, dass wir soziale Tiere (social animals) sind und deshalb gar nicht anders können, als im Austausch, in der Interaktion mit anderen unsere Geschichte zu erzählen (vgl. Schechtman 2018).
Auch wenn Menschen mit Demenz oberflächlich betrachtet nicht mehr zu wissen scheinen, wer sie sind, gibt es eine tiefere Schicht: das, was sich im Leibgedächtnis manifestiert hat und die Lebensgeschichte der Person. In dieser Hinsicht wissen Menschen mit Demenz noch, wer sie sind.
Martina Schmidhuber ist in Innsbruck an der Fachhochschule Gesundheit und an den Tirol Kliniken tätig. Ab Oktober 2019 ist sie Professorin für Health Care Ethics an der Universität Graz.
Literatur
Diehl, J./Förstl, H./Kurz, A. (2005): Alzheimer-Krankheit. Symptomatik, Diagnose und Therapie, in: Zeitschrift für medizinische Ethik 51; 1: S. 3-12.
Engedal, K. (2019): Standards in Dementia Care. An European Perspective, in: M. Schmidhuber et al. (Hg.), Menschenrechte für Personen mit Demenz. Soziale und ethische Perspektiven, Bielefeld, S. 19-33.
Fuchs, T. (2008): Leibgedächtnis und Unbewusstes. Zur Phänomenologie der Selbstverborgenheit des Subjekts, in: Psycho-Logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur 3, S. 33-50.
Füsgen, I. (2001): Demenz. Praktischer Umgang mit der Hirnleistungsstörung, Berlin.
Jungert, M. (2018): „Ich habe mich sozusagen selbst verloren“ – Biographische Identität, autobiographisches Gedächtnis und Alzheimer-Demenz, in: Zeitschrift für Praktische Philosophie 5; 1: S. 133-152.
Schechtman, M. (2018): Practice and Identity. An Anthropologcal View of Persons, in: J. Noller (Hg.), Was sind und wie existieren Personen? Probleme und Perspektiven der gegenwärtigen Forschung, Paderborn, S. 133-146.
Schechtman, M. (2007): The Constitution of Selves, New York.
Schmidhuber, M./Gräßel E. (2018): Zur Vulnerabilität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen,in: L. Bergemann/A. Frewer (Hg.), Autonomie und Vulnerabilität in der Medizin. Menschenrechte – Ethik – Empowerment, Bielefeld, S. 147-166.
Schöne-Seifert, B. (2007): Grundlagen der Medizinethik, Stuttgart.


