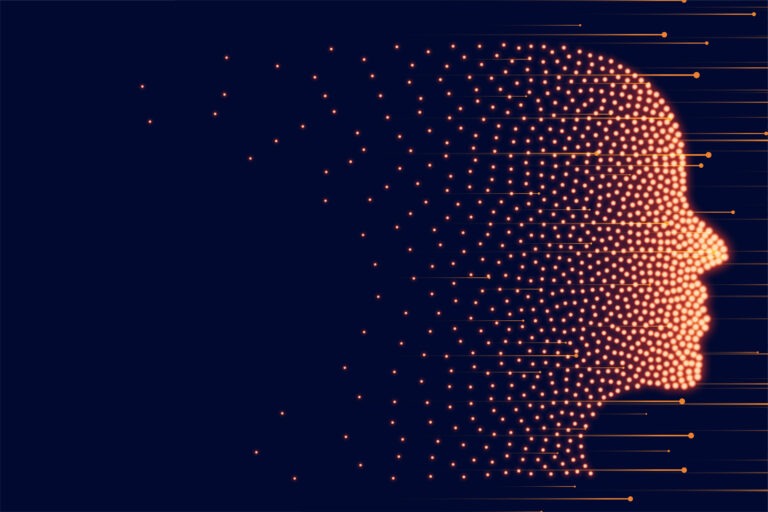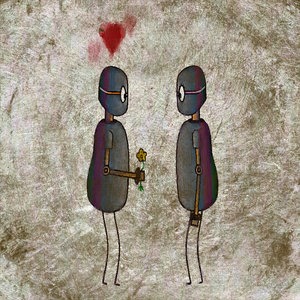
Können Menschen Liebe machen? Eine inklusive Perspektive auf Liebe, Freundschaft und Sex mit nichtmenschlichen Wesen
Von Janina Loh (Wien)
Vor einiger Zeit traf ich in einem Bus in Berlin auf eine alte Frau, die offenkundig ohne Begleitung war. Sie hatte eine kleine Wunde am Bein. Nachdem ich ihr vom Busfahrer ein Pflaster besorgt hatte, fragte ich sie, wohin sie wolle und ob ich ihr vielleicht behilflich sein könne. Die Antwort, die sie mir mit einem müden Lächeln gab, verblüffte mich: Ihr gehe es gut, bedankte sie sich, sie wolle nirgendwo hin. Sie fahre jeden Tag Bus, nur, um unter Leuten zu sein, denn sonst wäre sie ganz allein. Diese Begegnung liegt nun mehrere Jahre zurück, doch immer wieder kehre ich in Gedanken zu ihr zurück.
Menschen haben eine faszinierende Fähigkeit: Sie können Beziehungen eingehen. Sie binden sich an ein Gegenüber, das in manchen Fällen (wie bei der Frau im Bus) gar nicht konkret sein muss und in zahlreichen anderen Fällen noch nicht einmal menschlich. So vielfältig die Arten des Kontakts, der sich etwa in Geschäfts-, Liebes-, sexuellen und freundschaftlichen Beziehungen realisiert, so facettenreich das mögliche Gegenüber: Menschen erkennen Tiere als Familienmitglieder an, um deren Ableben sie trauern, sie spielen ihren Zimmerpflanzen auf der Violine vor, um ihr Wachstum anzuregen, sie hängen über Jahrzehnten an ihren Schnuffeldecken und geben ihren Autos Namen. Glaubt man Hannah Arendt, liegt das vielleicht daran, dass Menschen bereits in ihrem Denken niemals gänzlich allein, immer schon an ein imaginiertes Gegenüber gebunden sind. Arendt nennt diese Tatsache menschlichen Daseins das innere Zwiegespräch zwischen mir und mir selbst. Und jede Beziehung, die ein Mensch eingeht, ist Ausdruck davon.
Das gilt auch für Beziehungen zu Unbelebtem. Objekte wecken unterschiedliche Gefühle in uns, sie vermitteln Geborgenheit, leisten Gesellschaft oder regen uns auch mal auf. Ganz ehrlich: Wer von Ihnen hat noch niemals den Computer angeschrien, wer besitzt eine Lieblingstasse, eine Glückssocke oder spricht mit dem alten Spielzeugteddy? Einige von uns gehen sogar intime Verbindungen mit Objekten ein: So heiratete Aaron Chervenak 2016 in Las Vegas sein iPhone und die Berlinerin Michelle lebt seit 2014 in einer festen Partnerschaft mit einer Boeing 737-800. Die beiden sind damit Mitglieder einer seltenen Gruppe von Menschen, denen Objektophilie ›diagnostiziert‹ wird, also eine ungewöhnlich stark ausgeprägte emotionale Bindungsfähigkeit an bestimmte Gegenstände. Entgegen der gängigen Reaktionen, über solche und ähnliche Fälle zu lachen, empört den Kopf zu schütteln oder sie als pathologisch bzw. ›verrückt‹ abzutun, interpretiere ich sie als ehrliche, wenngleich auffällige Beispiele der besagten Fähigkeit, Beziehungen nicht nur zu jedem (Menschen und Tier) sondern auch zu allem (Unbelebten und Objekthaften) eingehen zu können.
Aber – so wird die eine oder der andere an dieser Stelle vielleicht einzuwenden geneigt sein – mache ich es mir nicht ein bisschen zu einfach, wenn ich alle Beziehungsarten über einen Kamm schere? Ist denn nicht eine Geschäftsbeziehung von ganz anderer Qualität als eine freundschaftliche Beziehung? Und sich Schutz und Geborgenheit suchend in die Lieblingsdecke hinein zu kuscheln bedeutet doch noch lange nicht, die Decke auch zu lieben. Also sind Michelle und Aaron vielleicht doch ›nicht ganz dicht‹, wenn sie ihre iPhones heiraten und sexuellen Umgang mit Modellflugzeugen pflegen? Diesem Urteil hätte zumindest Aristoteles zugestimmt, der Freundschaften aus Lust, Nutzen und Tugend unterscheidet und die Möglichkeit von Freundschaft mit unbeseelten Dingen dabei kategorisch ausschließt. Diese These untermauert er mit einer entsprechenden Theorie von Beseeltheit, der die Mehrheit der Leser*innen sicherlich intuitiv zustimmen würde. So scheinen sich Objekte doch gerade dadurch zu definieren, dass sie tot sind, also keine Seele haben, eben bloß Dinge sind. Aus eben diesem Grund lassen sich Aristoteles zufolge mit ihnen weder Freundschaften im genuinen Sinne eingehen, noch Liebesbeziehungen führen, noch echte sexuelle Akte ausüben. Freundschaft und Liebe mit unbelebten Objekten, wäre, so würde Aristoteles vermutlich bemerken, ein Kategorienfehler und Selbsttäuschung, Sex mit Dingen einfach Masturbation.
Andererseits lässt sich darüber, was eine Seele ist und welchen Entitäten im Kosmos eine solche zukommt, vortrefflich streiten. Die Antwort auf diese Frage ist auch kulturspezifisch: So steht Aristoteles mit seiner Position exemplarisch für die klassisch westliche Sicht der Dinge, im Animismus hingegen wie im japanischen Shintōismus oder auch in der germanischen Mythologie ist die Vorstellung von beseelten Objekten fundamental. Zudem begründen Leute wie Michelle und Aaron ihre Bindung an die geliebten Gegenstände gar nicht einmal damit, dass diese mit einer Seele ausgerüstet und deshalb liebenswert seien, sondern damit, dass sie die Erwartungen, die die beiden jeweils an Liebesbeziehungen stellen, vollständig erfüllen: im und mit dem Gegenüber zur Ruhe zu kommen, gemeinsam einzuschlafen, eine erfüllte Sexualität zu haben, Gespräche zu führen, sich wertzuschätzen.
Daher möchte ich eine andere Definition von (freundschaftlichen) Beziehungen vorschlagen, die nicht notwendig an die Bedingung der Beseeltheit geknüpft ist: Eine Beziehung bis hin zu einer Freundschaft kann man desto eher mit einem Gegenüber eingehen, je mehr es eine befriedigende Antwort auf die eigenen Bedürfnisse zu geben imstande ist. Inwiefern und in welchem Ausmaß das jeweils der Fall ist, unter welchen Umständen etwas als angemessene Antwort interpretiert wird, mag jeder Mensch für sich individuell entscheiden. Erinnern wir uns etwa an E. T. A. Hoffmanns berühmte Erzählung Der Sandmann, in der sich der Student Nathanael in eine automatisierte, humanoide Holzpuppe namens Olimpia verliebt, freilich ohne zu wissen, dass es sich bei der betörenden Kunstfigur um einen leblosen Apparat handelt. Obwohl im Gespräch wortkarg und in ihrem sonstigen Verhalten eher einfach gestrickt, kann Olimpia Nathanael doch zunächst die von ihm gewünschte Antwort auf seine Bedürfnisse geben. Wer von uns mag darüber urteilen, ob diese Form der Zuneigung besser oder schlechter ist, von ›höherer Qualität‹ gar als die zu einem anderen Wesen? Handelt es sich doch bei den Themen Freundschaft, Liebe und Sexualität um die intimsten und für viele Menschen wertvollsten Bereiche des menschlichen Daseins. Ein inklusiver Ansatz, wie ich ihn vertrete, möchte die Fähigkeiten der Menschen, sich emotional an alle möglichen Formen des menschlichen und nichtmenschlichen Gegenübers zu binden, in den Vordergrund stellen und gegenüber exklusiven Ansätzen der Diskriminierung und Degradierung bestimmter Weisen, in denen Menschen Beziehungen eingehen, hervorheben.
Das einende Vorhaben der inklusiven Ansätze wie ich sie verstehe, ist insofern ein inklusives Programm, als weder die Position ›des‹ Menschen gegenüber der anderer Wesen hervorgehoben und abgesichert (exklusiver Autoritarismus[1]) oder ›der‹ Mensch auf die ›Ebene‹ aller anderen Wesen herabgestuft werden, also mit ihnen gemeinsam moralisch degradiert und diskriminiert werden, soll (exklusiver Relativismus). Inklusive Ansätze werten im Gegensatz zu diesen exklusiven Theorien weder ›den‹ Mensch als besonders und moralisch vorzugswürdig im Vergleich mit allen anderen Wesen auf (die klassische anthropozentrische Position). Noch schließen sie ›denselben‹ aus dem genuinen Bereich des Moralischen aus (was den Weg für einen konsequenten Relativismus vorbereitet). Sondern inklusive Positionen suchen eher, alle anderen Wesen auf dieselbe ›Stufe‹ der Menschen zu stellen und sie damit als moralisch ebenbürtige Gefährt*innen in das moralische Universum, in dem sich auch die Menschen befinden, zu inkludieren. Will sagen, inklusive Ansätze wollen weder den Menschen moralisch relevante Eigenschaften absprechen (die Sorge des exklusiven Autoritarismus), noch ihre Rechte als Menschen beschränken (die Befürchtung des exklusiven Relativismus). Wohl haben inklusive Theorien den Anspruch, auf die zuweilen fragwürdigen Menschenbilder, die moralisch und rechtlich herausragenden Institutionen wie etwa den Menschenrechten und dem Humanismus zugrunde liegen und die in der Vergangenheit eine Vereinnahmung und Instrumentalisierung derselben zu diskriminierenden Zwecken aufgrund eben der fraglichen Menschenbilder nicht viel entgegenzusetzen hatten, aufmerksam zu machen und über mögliche Alternativen nachzudenken.
Ein berühmtes Beispiel für einen inklusiven Ansatz formuliert etwa Donna Haraway in Staying With the Trouble in Form einer Ethik der Verwandtschaft aus, die ihr zufolge im eigentlichen Sinne erst der Frage nach Verantwortung gerecht werden kann. Denn »[s]ich auf eigensinnige Art verwandt zu machen« schafft Bezüge und reicht weit über die engen Grenzen »der göttlichen, genealogischen und biogenetischen Familie« hinaus. Wer in eine jeweilige »Sippe« aufgenommen wird, mit wem wir uns jeweils verwandt machen, bleibt zwar offen und individuell festzulegen. Allerdings geht es Haraway an dieser Stelle vorrangig darum, damit ernst zu machen, die Grenzen dessen, was wir bislang als Familie oder Freundeskreis definiert haben, zu erweitern und nun auch offiziell jene Wesen mit ins moralische Universum aufzunehmen, die wir implizit bislang schon zuweilen dort lokalisiert haben – wie etwa bestimmte Haustiere. Die »wilde Kategorie« der Verwandtschaft führt dazu, dass wir »unruhig […] bleiben« (alle Zitate in Haraway, Unruhig bleiben, S. 10-13). Das bedeutet, dass wir die Widersprüchlichkeiten, die unaufhebbaren Spannungen unseres Daseins genießen und die Ironie darin sehen lernen, wie Haraway bereits in ihrem Cyborg Manifesto bemerkt: »Ironie handelt von Widersprüchen, die sich nicht – nicht einmal dialektisch – in ein größeres Ganzes auflösen lassen, und von der Spannung, unvereinbare Dinge beieinander zu halten, weil beide oder alle notwendig und wahr sind« (Haraway, »Ein Manifest für Cyborgs«, S. 33). Indem wir uns verwandt machen, können wir unruhig bleiben, also die notwendigen Spannungen, Dichotomien und Widersprüche anerkennen und lustvoll mit ihnen ringen. Denn nur weil sie von Menschen gemacht, gesellschaftlich konstruiert, sind, heißt das noch lange nicht, dass Kategorien und Dichotomien nicht auch notwendig sind. Wir müssen im Alltag häufig differenzieren, um handlungsfähig zu bleiben. Aber es ist eine offene Frage, welche Unterscheidungen wir treffen und wen wir dadurch ggf. aus dem Kreis der moralisch bedenkenswerten Wesen in einer jeweiligen Situation ausschließen. »Wir werden miteinander oder wir werden gar nicht« (Haraway, Unruhig bleiben, S. 13). Unruhig zu bleiben, »ist unsere Aufgabe« (Haraway, Unruhig bleiben, S. 9), denn nur so kann auf Missstände hingedeutet, können Exklusionen erst anerkannt und zu einem kritischen Bewusstsein gebracht werden.
Wen jedoch das Thema Liebe, Freundschaft und Sex mit Blick auf Objekte zu sehr irritiert, der sei an weniger intime Formen der Beziehung erinnert: In der Servicerobotik werden derzeit artifizielle Systeme entwickelt, die Menschen in ihrem Alltag zur Hand gehen sollen. Ob der Staubsaugerroboter Roomba (iRobot), Rasenmäherroboter wie der Automower (Husqvarna), der Verkaufsassistent Paul, der Kund*innen durch die Gänge des Elektrohandels Saturn führt, oder die gegenwärtig in ihren Fähigkeiten noch recht eingeschränkten Haushaltsassistenzsysteme und Unterhaltungsroboter wie Pepper (Aldebaran Robotics SAS in Kooperation mit SoftBank Mobile Corp.) – sie alle stehen für die wachsende Gruppe der sozialen Roboter, die im Nahbereich der Menschen zum Einsatz kommen und daher über soziale Kompetenzen verfügen müssen, abhängig davon, was ihre jeweilige Aufgabe ist und inwieweit sie damit in direkte Interaktion mit Menschen treten.
In den Bereichen Pflege und Therapie ist das Eingehen von Beziehungen zwischen Mensch und Maschine vielleicht noch offensichtlicher: Eine von William A. Banks 2007 durchgeführte Studie hat ergeben, dass alte Menschen zu einem Roboterhund (in diesem Fall AIBO von Sony) eine ganz ähnliche Bindung aufbauen können wie zu einem lebenden Hund. Der Roboterrobbe Paro gegenüber (entworfen von Takanori Shibata), öffnen sich insbesondere demenzkranke Menschen, die oftmals dazu neigen, sich von ihren menschlichen Betreuer*innen zu isolieren.
Ich bin mir sicher, dass auch die alte Frau, der ich vor vielen Jahren in Berlin im Bus begegnet bin, ihre Freude an AIBO, Paro und Co. hätte. Vielleicht kann ein*e artifizielle*r Begleiter*in ihr nicht jeden menschlichen Umgang ersetzen, aber doch zumindest ihre Einsamkeit ein wenig lindern. Vielleicht würde sie mit ihm aber auch einen späten zweiten Frühling erleben, sich ehrlich verstanden und wertgeschätzt fühlen in einer Weise, in der sie von Menschen schon lange keine Zuneigung mehr erhält. Menschen verlieren ihre wunderbare Fähigkeit, Beziehungen mit jedem und allem eingehen zu können, nicht urplötzlich durch den Einsatz von Robotern. Mir persönlich ist die Kultivierung dieser menschlichen Beziehungskompetenz – ganz egal, zu welchem Gegenüber – viel wichtiger, als darüber zu diskutieren, ob die Zuneigung zu einem Menschen besser ist als die zu einem Tier, einer Pflanze oder einem Roboter.
In dem Bändchen Können Roboter Liebe machen? Unterhalten sich Laurent Alexandre und Jean-Michel Besnier u.a. über diese Frage der Möglichkeit sexueller Beziehungen mit Maschinen. Sie verbleiben dabei leider in dem engen Korsett des Aristotelischen Paradigmas. Ich hingegen würde einwenden, dass Roboter natürlich Liebe machen können – sofern sie von einem Menschen als angemessenes sexuelles Gegenüber anerkannt werden, d.h., sobald Menschen zulassen, dass Roboter (oder andere nichtmenschliche Wesen) Liebe machen können. Interessanter ist aus meiner Sicht die Frage, ob Menschen Liebe machen (im Sinne von herstellen) können, d.h. ob Menschen in der Kreation von Robotern nun emotionale Bindungen (bspw. im Bereich der Social Robotics, wie oben ausgeführt) produzieren. Die Antwort auf diese Frage lautet Nein, denn was Menschen allenfalls tun, ist ein neues Potenzial für das Eingehen von freundschaftlichen, sexuellen und Liebesbeziehungen zu eröffnen. Niemand kann dazu gezwungen werden, sich an eine Maschine zu binden, niemanden kann man zur Liebe zu einem unbelebten Objekt nötigen, Liebe mit gleich welchen Wesen kann nicht hergestellt, gemacht werden.
Ich halte es für perfide, wenn sich jemand in einer Zeit der zunehmenden Alterseinsamkeit, der frappierenden Ausbeutung und großen körperlichen Belastung in Altenpflegeberufen gegen den Einsatz von Assistenzsystemen sträubt, weil sie* die Sorge hat, Menschen würden dann aufhören, Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Wann haben Sie zuletzt Ihre Verwandten und Bekannten im Altersheim besucht? Während Sie diese Zeilen lesen: Wer von Ihnen streicht dabei gelegentlich gedankenverloren und fast zärtlich über das Smartphone, das neben Ihnen auf dem Tisch liegt?
Dr. Janina Loh (geb. Sombetzki) ist Universitätsassistentin im Bereich Technik- und Medienphilosophie der Universität Wien. Dieser Text wird in ähnlicher Weise in ihrem Buch Roboterethik. Eine Einführung publiziert, die im September 2019 bei Suhrkamp erscheint.
[1] Der Begriff »Autoritarismus« ist nicht gut gewählt. Ich suche noch nach einem passenden Terminus.