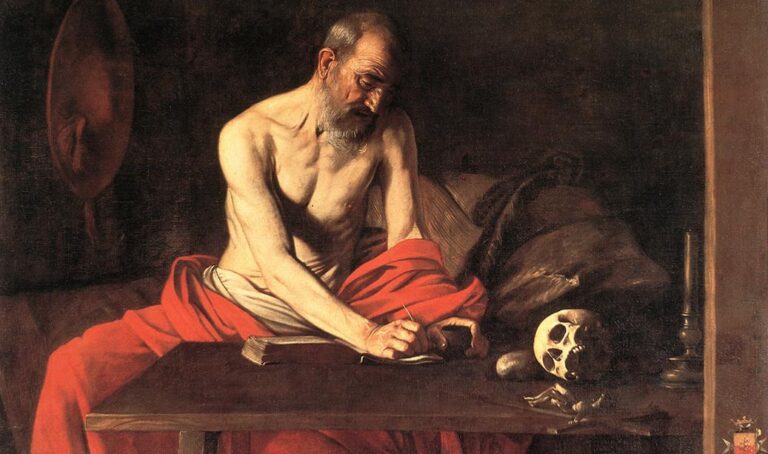Suizid: Zwischen Freiheit und Verantwortung
Von Achim Wamßler (Berlin) –
Der Beitrag befasst sich mit der Frage der individuellen Verantwortung von Suizidenten. Er argumentiert gegen eine humesche Position der absoluten freien Entscheidung für den Tod im luftleeren Raum, ohne dabei den potentiellen Suizidenten die letztendliche Wahl aus der Hand zu nehmen.
Einleitung
Selbstbestimmter Tod ist heutzutage merkwürdig zwiespältig. Einerseits hat sich schon seit langem die liberale Haltung durchgesetzt, nach der die Selbsttötung in humescher Manier prinzipiell Entscheidung jedes Einzelnen ist. Nicht nur ist Suizid in vielen Ländern seit Anfang des 20. Jahrhunderts juristisch straffrei. Auch stellt es in öffentlichen Debatten sowie Diskussionen um einzelne Suizidfälle eine absolute Ausnahme dar, Selbsttötung als moralisch verwerflich zu brandmarken. In Kunst und Medien herrscht in der Regel ein Ton der Betroffenheit oder gelegentlich auch einer der Ironie – man denke nur an den Tod Rex Gildos oder im Blumentopf-Klassiker 6 Meter 90.
Andererseits ist damit der Suizid aber nicht vollständig der Be- und Verurteilung entzogen. Man denke hier zum Beispiel an Selbstmordanschläge, medizinische Interventionen bei Suizidversuchen oder soziologische Debatten um die Rolle von Staat und Gesellschaft. Während erstere nicht nur wegen des Leides, das sie verursachen, moralisch verwerflich sind, sondern auch weil sich die Täter dadurch ihrer Verantwortung entziehen, die medizinische Beurteilung wiederum dazu führt, dass den Suizidenten ihre Autonomie abgesprochen wird, verschiebt die soziologische Debatte die Frage nach der moralischen Verantwortung auf überindividuelle Strukturen wie Gesellschaft oder Staat).
Doch selbst wenn man von diesen Bereichen und einigen Grauzonen einmal absieht (was im Folgenden getan werden soll), lässt sich hinter die liberale Position mehr als ein Fragezeichen setzen. Das zeigt sich bereits daran, dass das wesentliche Merkmal (wohlgemerkt guter) moralischer Debatten in der Regel gerade darin besteht, je nach Kontext zu differenzieren. So enden zum Beispiel die Debatte um die Legitimität von Diebstahl nicht in einem bloßen „erlaubt“ oder „nicht-erlaubt“, oder die Debatte um zivilen Ungehorsam nicht in einem einfachen „straffrei“ oder „strafbar“. Moralische Debatten sind Prozesse, in denen es um das Aushandeln von Grenzen geht, die nicht von selbst oder objektiv eindeutig sind und gerade deshalb zur Diskussion stehen. Auch deshalb geht es in ihnen immer auch darum, durch Gründe und das Schaffen von Einsicht in eine Sache, Verständnis beim und Gemeinsamkeit mit dem Gegenüber zu erzeugen. Beim Thema Suizid scheint dies aber gerade nicht der Fall zu sein: Die Entscheidung, so die seit Langem vorherrschende Meinung, liegt bei jedem Einzelnen – und nur bei ihr. Verantwortung kommt in der liberalen Position wenn dann einer Gesellschaft nur im Allgemeinen zu, insofern sie es nicht schafft, Suizide zu verhindern.
Dieser fragwürdigen und zwiespältigen Thematik möchte ich im Weiteren mit der folgenden These begegnen: Ja, jeder hat prinzipiell das Recht darauf, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen. Aber anstelle eines Endes der Debatte um die individuelle Verantwortung, sollte dieses Recht in der Debatte gerade dazu führen, neben der gesellschaftlichen Verantwortung auch die moralische des Einzelnen herauszuarbeiten.
Freiheit im luftleeren Raum?
Doch man ahnt bereits den umgehenden Widerspruch liberaler Vertreter: Nimmt man dem Einzelnen dadurch, dass ihm eine moralische Verantwortung aufgebürdet wird, nicht gerade die Freiheit, sich das Leben zu nehmen? Schränkt die Aufforderung, Gründe und womöglich noch gute Gründe geben zu können, nicht gerade die Handlungsfreiheit des Individuums ein?
Die Antwort lautet: Ja. Aber entgegen dem liberalen Tonschlag, dass diese Einschränkung ein ungerechtfertigtes Hindernis bei der Ausübung des eigenen Willens darstelle, spricht viel dafür, dass es diese liberale Position selbst ist, die hinterfragt werden muss. So spricht gegen eine Praxis des Suizids, die sich ganz ohne Berücksichtigung der Folgen des Handelns vollzieht, bereits die empirische Tatsache, dass wir im alltäglichen Umgang mit Suizid diesen intuitiv danach bewerten, ob und inwiefern er gerechtfertigt ist. Eine der ersten Fragen, wenn wir mit einer (versuchten) Selbsttötung konfrontiert werden, ist die nach den Gründen.
Und dabei fragen wir nicht aus reiner Neugierde oder aus einer irgendwie im luftleeren Raum schwebenden Betroffenheit heraus, sondern weil wir bessere oder schlechtere Gründe erwarten. Dies liegt daran, dass der Tod und damit auch Freitod eben gerade nicht eine Selbstverständlichkeit wie Eis essen, atmen oder (ganz allgemein) leben ist. Suizid bedarf sozusagen natürlicherweise der Begründung. Sich wegen eines abgebrochenen Fingernagels das Leben zu nehmen, kommt niemandem in den Sinn und würde auch von außen auf Unverständnis stoßen – und dies auch dann, wenn gilt, dass es keinen objektiven Maßstab für Leiden gibt, der einem Akteur von außen ein bestimmtes Handeln vorschreiben kann. Vielmehr noch: Ein mögliches Unverständnis, mit dem Hinterbliebene konfrontiert werden, belastet diese oft so sehr, dass es ein großes Bedürfnis danach gibt, Gründe für den Suizid zu finden. Dies hat zur Folge, dass gerade bei Ausbleiben von plausiblen Gründen, oft psychische Diagnosen in die Diskussion des Geschehenen mit einfließen. Am auffälligsten zeigt sich dies in öffentlichen Debatten um Suizid(versuche) von prominenten Persönlichkeiten. Der kürzliche Versuch von Wolfgang Krupp oder der natürliche Tod Betsy Arakawa und ihres Mannes Gene Hackman geben hier gute Beispiele ab: In der medialen Begleitung beider Geschehnisse konnte man förmlich das Aufatmen der Öffentlichkeit hören, nachdem beim ersten eine Altersdepression als Grund des Versuches öffentlich wurde und bei Arakawas und ihres Mannes ein natürlicher Tod und kein Suizid als Ursache zum Vorschein kam.
Aber nicht nur der gesellschaftliche empirische Umgang mit Suizid spricht gegen die Vorstellung, jedes Individuum sollte sich ganz ohne moralische Hindernisse das Leben nehmen können. Eine solche Haltung steht auch mit dem dabei verwendeten Begriff der freien Entscheidung in Widerspruch. Denn die Tatsache, dass wir den Akteuren eine freie Entscheidung bezüglich ihres Todeszeitpunktes zuschreiben, ist gleichbedeutend damit anzunehmen, es gäbe Gründe dafür und dagegen. Denn Entscheidungen beruhen auf Abwägungen von Gefühlen und rationalen Argumenten. (Die Wahl zwischen zwei Optionen ohne jegliche Gründe – wenn es so etwas geben sollte – wäre keine aktive Handlung hin zu einer der Optionen, was durch den Begriff „Entscheidung“ impliziert wird, sondern eine Form von Zufall). Mit Bezug auf das Leiden – empirisch wohl einer der wichtigsten Gründe für Freitod – stehen bei der Suizid-Entscheidung also Abwägungen und Argumente im Vordergrund hinsichtlich der Stärke, Qualität etc. des Leidens sowie der Konsequenzen. Wer also die Frage nach den Gründen selbst schon als problematisch betrachtet, der zweifelt auch daran, dass Suizid überhaupt ein Thema ist, bezüglich dessen man sich frei entscheiden kann.
Ebenen der Verantwortung
Welche moralische Verantwortung kommt den Suizidenten aber zu? Es liegt nahe, dass diese sich auf die Konsequenzen beziehen muss, die eine solche Tat mitsichbringt. Denn moralische Verpflichtungen hat man in der Regel gegenüber anderen. Und hinzu kommt im Falle des Freitods, dass man sich mit diesem gerade die Möglichkeit nimmt, auf das einzuwirken, was das eigene Handeln verursacht. Es ist also geboten, die Konsequenzen im Vorhinein gründlich zu bedenken.
Hier schließt sich abermals ein Einwand an: Ließe sich nicht behaupten, dass eine freie Entscheidung nicht erst mit der Berücksichtigung der Konsequenzen gegeben sei, sondern ganz ohne Blick auf andere, nämlich insofern es eine Abwägung des eigenen Leides sei, etwa des jetzigen Schmerzes gegen dessen Länge und gegen das Glück, das einem noch erwartet? Die Diskussion über Konsequenzen und das Leid, das ein Suizid bei anderen auslöst, wäre damit nur eine Ausweitung der Berücksichtigung von Gründen, und es gäbe keine moralische Notwendigkeit oder Pflicht, dass die Suizident*in sie in ihrer Entscheidung mit reflektieren sollte.
Jedoch basiert dieser Einwand auf einer selektiven Berücksichtigung von Gründen. Und damit steht er in Spannung mit dem Gedanken einer freien Entscheidung, insofern er (wie schon der oben diskutierte Einwand) auf der Annahme fußt, eine Entscheidung finde im luftleeren Raum statt und sei entweder frei oder nicht frei. Aber das Gegenteil ist der Fall: Entscheidungen sind immer kontextabhängig und deshalb auch immer mehr oder weniger frei, je nachdem welche und wie viel Kontext und Entscheidungsaspekte dabei eine Rolle spielen. Die Entscheidungsfreiheit einer Person wächst also mit der Berücksichtigung von Konsequenzen und schrumpft mit ihrer selektiven Wahrnehmung. Und da das Ziel eine möglichst freie Entscheidung für oder gegen den eigenen Suizid ist, ist es moralisch geboten, auch die Konsequenzen für andere mit in die Abwägung einfließen zu lassen.
Nichtsdestotrotz ist es von Bedeutung, bei der Entscheidungsfindung auch moralische Fragen mit zu berücksichtigen, die sich alleine auf die Suizidentin beziehen – etwa nach der Größe und Dauer von Schmerz, Angst oder Sinnverlust oder deren spezifischen Qualitäten. Besonders sinnvoll kann dies etwa sein, wenn man diese Fragen mit philosophischen Positionen bspw. dem Stoizismus oder modernen Angeboten des Hospizes in Verbindung bringt. Denn auf diese Weise lassen sich Möglichkeiten des Umgangs untersuchen und erörtern, inwiefern und unter welchen Gesichtspunkten und vor welchen Prämissen ein Suizid vor einem selbst gerechtfertigt ist.
Dies gilt im Übrigen auch, obwohl es kein objektives Maß dafür gibt, wann eine bestimmte Qualität oder Quantität des Leides den eigenen Tod rechtfertigt und wann nicht. Zwar können Fragen, wie beispielsweise, ob Bauchspeicheldrüsenkrebs – der nach geläufiger Meinung eine der schmerzhaftesten Krebsarten sein soll – eher einen Suizid rechtfertigt als die Schmerzen einer anderen Krebsart, letztendlich nur von der betroffenen Person auf Grundlage ihres subjektiven Empfindens beantwortet werden. Dennoch kann eine Diskussion und Reflexion darüber durchaus hilfreich sein, das jeweilige Empfinden und dessen individuelles Erleben besser zu begreifen und zu bewerten.
Abwägung von subjektiven und objektiven Gründen
Das wesentliche Moment einer Suizid-Entscheidung, die auch das Umfeld mit einbezieht, besteht offensichtlich darin, dass sie sich in einem intersubjektiven Raum vollzieht. Damit werden Wahrnehmung und Empfindungen anderer Personen zum wichtigen Kriterium der Entscheidung.
Die bei der Entscheidungsabwägung relevanten ethischen Fragen hinsichtlich der Konsequenzen sind demnach erstens, welche Folgen dies für das Umfeld hat und zweitens, wie diese Folgen im Vergleich zu den anderen Entscheidungsebenen (wie bspw. die Größe und Dauer eines physiologischen Schmerzes oder einer Angst, eines perspektivischen Verlusts der Lebensqualität etc.) gewichtet werden.
Während die Gewichtung selbst wiederum nur vom sterben wollenden Menschen vorgenommen werden kann, da es für die herangezogenen Vergleichskriterien wie der Größe des Schmerzes etc. kein objektives Maß gibt, lässt sich einiges über die andere Seite – die Hinterbliebenen – sagen, die Teil des Abwägungsprozesses ist.
Wirtschaftliche Erwägungen
Dürfen wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle spielen? Dass dies de facto der Fall ist, dies legen diverse Studien nahe, die einen signifikanten (statistischen) Anstieg von Suiziden bei Arbeitslosigkeit oder bspw. während der Finanzkrise 2007 bis 2009 belegen.
Die moralphilosophisch interessante Frage ist jedoch, ob die finanzielle Notlage, in die jemand Ihre*seine Angehörigen durch Ihren*seinen Suizid bringt, ein Hinderungsgrund darstellen sollte, sich das Leben zu nehmen. Zumindest in Sozialstaaten wie Deutschland scheint dies auf den ersten Blick ein weniger relevantes Thema, da aufgrund sozialstaatlicher Absicherung Fragen der Versorgungssicherheit der Familie nicht aufkommen sollten. Bei genauerer Betrachtung lässt sich dies aber bezweifeln. Einerseits kann durch den Verlust des Jobs, das Verspielen des Vermögens und dergleichen Dinge die eigene Familie in die Lage gebracht werden, das eigene Haus, Auto oder anderer Besitz verkaufen zu müssen, was bei den Angehörigen zu einem Verlust von Lebensart, Status bis hin zum Lebenssinn führen kann. Die Grenze zwischen wirtschaftlicher Bewertungsebene und anderen Aspekten des subjektiven Leids der Angehörigen ist demnach nicht nicht so klar, wie man das meinen könnte.
Das Leid der Nahestehenden
Damit kommen wir in den Bereich der ideellen Konsequenzen, die der Suizid eines Nahestehenden begleiten kann. Hierbei spielt das Leid und der Schmerz über den Verlust eine Rolle, die ein Suizid verursacht und die die potenzielle Suizidentin gegen das eigene Leid abwägen muss. Es erscheint also sinnvoll, diese Abwägung mittels Überlegungen einerseits zur psychischen Konstitution sowie zur Art des Umgangs der einzelnen Hinterbliebenen zu flankieren und andererseits zur Resilienz des sozialen Umfeldes im Ganzen.
Was die individuellen Konsequenzen anbelangt, können etwa Fragen wie “Wie groß wird das Leiden einzelner Nahestehender sein?“ oder „Ist es gerechtfertigt, dieses in Kauf zu nehmen?“ von Relevanz sein. So liegt nahe, dass das Leid im Rahmen einer Trauerbewältigung weniger schwer zu gewichten ist als ein erzeugtes Leid, das seinerseits zu Suizidgedanken oder gar einem Suizid bei den Hinterbliebenen führt. Dieses Leid der Angehörigen ist wiederum selbst subjektiv und damit schwer für die*den potenzielle*n Suizident*in einzuschätzen. Dies sollte sie*ihn aber nicht daran hindern, derlei Erwägungen in die Entscheidung mit einfließen zu lassen. Vielmehr zeigt dies, wie wichtig es sein kann, mit dem Umfeld über die Suizidabwägungen zu sprechen.
Eine weitere wichtige Frage knüpft an die vorherige an: Lässt sich der Tod für das Umfeld begreifbar machen? Das Rationalisieren eines Verlustes ist ein essenzieller Schritt der Verarbeitung von jedweder Art von Tod, insbesondere aber eines Suizids. Das Fehlen von Hinweisen auf (nachvollziehbare) Ursachen und Gründe kann es Angehörigen schwer bis unmöglich machen, über den Tod hinwegzukommen. Aus diesem Grund sollte bei der Abwägung und auch im Vorfeld eines Freitods in jedem Fall überlegt werden, in den Austausch mit Freunden und der Familie zu gehen. Oder zumindest sollte überlegt werden, ob ein Abschiedsbrief sinnvoll ist und welche Personen dabei direkt adressiert werden sollten, aber auch welche Personen vom Tod erfahren sollten sowie ob weitere Dinge darin erwähnt werden müssen, die entscheidend für den Umgang der Hinterbliebenen sind.
Eine ganz besondere Verantwortung trägt der potenzielle Suizident gegenüber Kindern. Dies ist gerade mit Blick auf die Frage der Fall, ob sich der Tod begreifbar machen lässt. Der Verlust einer emotional engen Person kann (nicht muss) für Kinder traumatische Folgen haben, weshalb Kindern besonderes Gewicht bei der Abwägung eingeräumt werden muss. Ihnen die Verantwortung zu überlassen, mit einem absoluten Verlust umzugehen, dafür müssen besondere Umstände vorliegen.
Damit ist natürlich nicht gesagt, dass diese Aspekte in jedem Fall gegen einen Suizid sprechen. Der Tod wird uns alle treffen. In Form des Todes anderer und schließlich unseres eigenen. In diesem Sinn stellt der Suizid eine Verantwortungsteilung mit den Hinterbliebenen dar, die darin besteht, mit dem uns alle immer wieder umgebenden Tod umgehen zu lernen. Die Konfrontation mit dem Tod einer nahestehenden Person kann also zum Anlass, ja zur Aufgabe (auch im positiven Sinn) werden. Ob dies der Fall ist oder nicht, kommt letztlich auf die nahestehende Person selbst an und muss deshalb im Einzelfall entschieden werden.
Aber nicht nur individuelle Aspekte sind wichtig für die freie Entscheidung zum Tod. Gerade die Frage nach sozialen Ressourcen, auf die Hinterbliebene bei der Verarbeitung zurückgreifen können, geben entscheidende Hinweise darauf, wie gut oder schlecht diese mit dem Verlust umgehen können. Wie groß ist der Freundes- und Familienkreis? Wie gut der Zusammenhalt darin? Welche finanziellen Mittel sind vorhanden, sich Hilfe und Beratung zu holen? Diese und weitere Fragen dieser Art sind relevant und sollten ebenfalls mit in die Überlegungen mit einbezogen werden.
Sicherlich sind die hier vorgebrachten Aspekte einer Entscheidung für oder gegen den eigenen Tod nur ein kleiner Ausschnitt aus einem viel umfangreicheren Abwägungsprozess. In diesem sind einerseits Kriterien relevant, die über die bloße Willkür und den subjektiven Leidensdruck hinaus gehen. Dennoch bedeutet dies nicht, dass damit dem suizidalen Subjekt die Entscheidungshoheit genommen ist. Richtiger ist es zu sagen, dass sie ihm moralisch verkompliziert wird. Da es sich um eine Abwägung von einerseits intersubjektiven Gründen, das heißt Gründen, die Andere betreffen und damit objektive(re)n Charakter besitzen, mit andererseits dem jeweiligen subjektiven Leid handelt und da zusätzlich nur die potenzielle Suizidentin bewertenden Einblick über Letzteres hat, kann die Entscheidung zum Ende des eigenen Lebens schlussendlich nur von dieser getroffen werden. Nichtsdestotrotz legen diese Überlegungen zur Abwägung zumindest nahe, als suizidale Person in einen Austausch mit seinem Umfeld zu treten. Denn auch das Leid, das durch den eigenen Suizid bei anderen erzeugt wird, ist letztlich subjektiv, und die suizidale Person kann sich deren Qualität und Quantität nur dann halbwegs versichern, wenn sie mit den Gegenübern ins Gespräch kommt.
Und vielleicht steht am Ende eines solchen Austauschs dann eine Situation, in der der*die Suizident*in mit ihrer Entscheidung nicht alleine auf sich zurückgeworfen dasteht, wie es die liberale Position suggeriert, sondern in der sie das Gefühl hat, noch im Sterben von nahestehenden Menschen verstanden und angenommen zu sein. Gesellschaftlich könnte so auf lange Sicht eine ethische Praxis entstehen, in der wir uns die Regeln unseres Ablebens und Suizids selbst sowie gegenseitig setzen.
Achim Wamßler ist Mitglied der praefaktisch-Redaktion. Er promovierte an der Freien Universität Berlin zu Hegel und arbeitet zur Zeit als freier Autor und Honorar-Dozent.