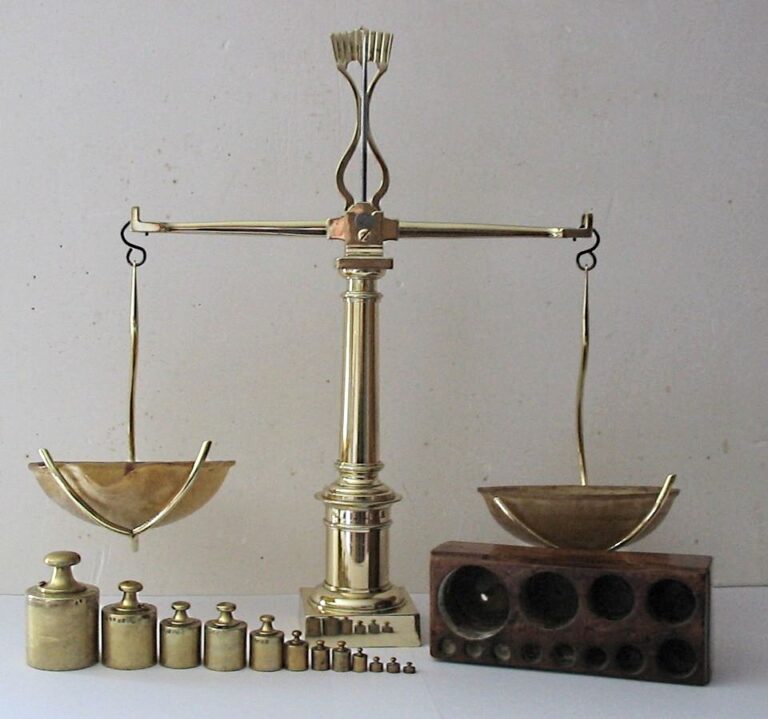Ruinierte Nachbarschaftlichkeit und ihre Folgen. Anmerkungen zu Omer Bartovs entwaffneter Erinnerung – mit Rücksicht auf Israel und Palästina, Osteuropa und ›uns‹
Von Burkhard Liebsch (Bochum)
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hielt die allgemeine Bedrohung durch kriegerische Gewalt im Zeichen der Doktrin der mutually assured destruction weiter an. Und doch glaubte man zumal während der Präsidentschaft Gorbatschows, Ost und West würden wirklich nach einem verlässlichen Frieden suchen. Den Weg dahin schien eher die fatale, alle Seiten behexende Logik der Abschreckung zu verbauen als irgendeine böse Absicht. Der durch Putin vom Zaun gebrochene Angriffskrieg gegen die Ukraine ist im Westen deshalb zunächst weithin mit geradezu paralysierter Ungläubigkeit quittiert worden. Man hielt es für ›undenkbar‹, dass nicht auch Russland auf dem Weg zu einer zwar extrem schwierigen, aber von allen Seiten zutiefst gewünschten Pazifizierung der europäischen Verhältnisse sein sollte, dass man dort skrupellos wieder zu Mitteln imperialistischer Brutalität greifen und im gleichen Zug jegliche Aufarbeitung der eigenen Gewaltgeschichte unterbinden könnte, wie sie u.a. von der russischen NGO Memorial betrieben worden war. Nachdem mit einer Verspätung von Jahrzehnten in Westdeutschland so etwas wie ›Aufarbeitung‹ der eigenen Gewaltgeschichte begonnen hatte, schien dagegen nicht nur hier, sondern bereits generell klar zu sein, dass ein Staat, der als solcher anerkannt werden will, wenigstens die Verbrechen vorbehaltlos eingestehen muss, die in seinem Namen (wenn auch u. U. nur von einem Teil der jeweiligen Bevölkerung) begangen worden sind. Sollte das nicht bis heute, für jeden Staat und für jede absehbare Zukunft gelten? Hatte das nicht auch Brandts Kniefall in Warschau deutlich gemacht, ohne mit dieser Geste im Geringsten Andere belehren zu wollen?[1]
Wie soll es je wieder zu halbwegs verträglichen nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Bosniaken und Serben auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien kommen, wenn letztere nicht bedingungslos das Massaker von Srebrenica zugeben – und zwar ganz unabhängig davon, was im Zerfall dieses Staates in Kämpfen um neue Staatsgebilde sonst noch vorgefallen ist? Zahllose andere, auf den ersten Blick ganz anders gelagerte Beispiele ließen sich anfügen, die belegen, dass es Staaten an der erforderlichen inneren und äußeren Anerkennung auf geradezu unheilbare Weise mangelt, wenn ihre gegenwärtige Existenz nicht von dem Eingeständnis getragen ist, dass es in ihrem Namen zu maßloser und womöglich unvergebbarer Gewalt gekommen ist. Lässt sich eine dennoch wieder annehmbare nachbarschaftliche, mit Anderen gegenseitig zu teilende Zukunft nicht allenfalls auf eine zunächst einseitige ›Moral‹ schonungslosen Eingeständnisses gründen?
Nur unter dieser Voraussetzung sollte auch die BRD nach und nach wieder in befriedete Verhältnisse guter Nachbarschaft in Europa eingefügt werden können. Das hat gar nichts mit einer in Anbetracht maßloser Verbrechen angeblich endlos fortdauernden Schuld zu tun, die es als »kollektive« nie gegeben hat. Vielmehr geht es bis heute darum, den inneren Zusammenhang zwischen staatlicher Gewaltgeschichte einerseits und Bedingungen akzeptabler Staatlichkeit andererseits zu begreifen und nicht wieder zu vergessen. Ein Staat, der nicht nur die Schwächsten (bzw. überhaupt erst zu ›Schwächsten‹ Gemachten) nicht schützt, sondern sie systematisch brutaler Diskriminierung mit schließlich vernichtenden Konsequenzen ausliefert, wie es das sog. Dritte Reich getan hat, zerstört sich im gleichen Zug als Staat selbst und hat weder im Innern noch auch in seinen äußeren Verhältnissen den geringsten Anspruch auf irgendein Ansehen. Ein Nachfolgestaat wie das jetzige Deutschland bzw. die ihn tragende Zivilgesellschaft muss derartige Diskriminierung, eingedenk der möglichen Folgen, so konsequent wie nur möglich zu unterbinden versprechen und wird nur unter dieser Voraussetzung auch als ›Nachbar‹ akzeptabel sein.
Zumindest bei denen, die nach 1945 dazu beigetragen haben, dass Einsicht in jenen inneren Zusammenhang in Deutschland zur Geltung kommen konnte, war sie engstens verbunden mit dem Wunsch, dass die europäischen Juden und die Juden weltweit für den Fall, dass ihnen erneut genozidale Verfolgung drohen sollte, wenigstens eine staatlich gesicherte Zuflucht in einem Land finden können, das stark genug sein sollte, sie vor der Wiederholung traumatischer Verfolgung wirksam zu schützen. So wurde und wird es bis heute auch in Israel gesehen, woran zuletzt Bartov in seinem jüngsten Buch erinnert hat.[2] Die auf diesen Wunsch gegründete politische Hoffnung für das jüdische Volk droht nun aber – wie so viele andere Hoffnungen auch, die infolge der Wiederkehr des Krieges nach Europa zerstört worden sind – vollständig ruiniert zu werden. Soll man es einfach ›Tragik‹ nennen, dass die Gefahr besteht, dass dazu auch die Politik der amtierenden israelischen Regierung selbst Beihilfe leistet, wenn sie im Verhältnis zu diskriminierten palästinensischen Nachbarn ständig sehenden Auges neue Feinde hervorzubringen droht, mögen sie jetzt auch noch in den Kinderschuhen stecken, ohne schon recht zu begreifen, was man ihnen angetan hat und wie man sie zu vernichtender Gegen-Gewalt überreden wird? Ist es nicht absehbar, dass diese Politik früher oder später neuen Terror hervorrufen wird, der auf palästinensischer Seite längst tausende neue Täter in spe rekrutiert, die Terror im asymmetrischen Machtverhältnis zum israelischen Nachbarn für das einzige noch verfügbare Mittel halten, ohne zu realisieren, dass sie auf diesem Wege jede gemeinsame Zukunft gleich mit zu zerstören drohen, auch die der eigenen Kinder und Kindeskinder?
Spätestens seit der Rückkehr des Ajatollah Chomeini in den Iran hatten sich die Israelis im Schatten von apokalyptischen Vernichtungsdrohungen zu behaupten, die bis heute von der Teheraner Führung und deren Gesinnungsgenossen einschließlich der Hamas immer wieder ausgestoßen werden und angesichts der iranischen Atomprogramme zweifellos ernst genommen werden müssen. Die israelische Selbstbehauptung in dieser Lage existenziellen Bedrohtseins mit exzessiver Gewalt, die das eigene Volk wiederum möglicherweise vernichten könnte, hat auf letzteres allerdings fatale Rückwirkungen. Wie die weltweit verurteilte Besatzungspolitik in Gaza angesichts von über 50.000 Getöteten auf palästinensischer Seite zeigt, verstrickt sich die dort verübte israelische Gegengewalt ihrerseits in immer weiter sich vertiefende Prozesse reziproker Verfeindung, in der sich die Radikalen beider Seiten zunehmend wenigstens darin einig zu werden scheinen, für die jeweilige Gegenseite nur noch ›endgültige‹ Vernichtung vorzusehen. An genozidaler Rhetorik mangelt es auf deren Seiten denn auch nicht. Intellektuelle im Westen haben diese Rhetorik und die von ihr befeuerte Gewalt zum Anlass eines hitzigen Streits über die Frage genommen, ob man auch der verantwortlichen Regierung Israels tatsächlich einen Genozid an den Palästinensern vorwerfen muss, wenn schon nicht ›den Juden‹ oder ›den Israelis‹ im Ganzen, die sich in dieser Frage ihrerseits als zerstritten erweisen.
In diesem Streit besteht zweifellos die Gefahr, wenn nicht gar bei manchen die Absicht, dabei prima facie ganz und gar Unvergleichbares – wie die Verhältnisse zwischen Palästinensern und Israelis, Muslimen und Juden einerseits, eine versuchte »Endlösung« wie die der Nazis mit diversen Genoziden, an denen unter der Überschrift »Unternehmen Barbarossa« auch zahlreiche osteuropäische Nachbarn beteiligt waren, andererseits auf eine Stufe zu stellen. In dieser verworrenen, polemisch aufgeladenen Lage hat ein unvoreingenommener, nüchterner Diskurs nahezu keine Chance mehr, wenn bereits die bloße Nebeneinanderstellung verschiedenartiger Gewalt – von der Shoah über die als Nakba bezeichnete Vertreibung der Palästinenser im Zusammenhang mit der Gründung des Staates Israel bis hin zu genozidalen Praktiken in Osteuropa – und erst recht jeder ›Vergleich‹ als skandalös und unannehmbar gewertet wird.
Auch diese Hoffnung droht nun zu sterben: dass man sich im Hinblick auf die vielfach als ›singulär‹ eingestufte Gewalt hinweg, zu der es wo auch immer gekommen ist, gleichsam lateral miteinander darüber verständigen könnte, was für die jeweils von ihr betroffenen Staaten auf dem Spiel steht, wenn sie sich nicht zu ihr bekennen. In dieser Hinsicht ist eine genaue Lektüre von Bartovs besonnenem Buch hilfreich. Dem in den USA lehrenden, in Israel geborenen Osteuropa-Historiker gelingt es, die Ost-West-Achse der Gewalt, zu der es infolge der Nazi-Herrschaft in Europa gekommen ist, gewissermaßen zu kreuzen mit der Nord-Süd-Achse des aussichtslos anmutenden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Und das tut er so, dass verständlich werden kann, wie die Vorgeschichte antisemitischer, in Europa seinerzeit weit verbreiteter Gewalt mit der Gegenwart eben der Gewalt verbunden sein könnte, die nun schwer auf den Schultern des israelischen Staates lastet. Genauer: auf den Schultern einer zwar demokratisch legitimierten, aber keineswegs alle Israelis repräsentierenden Regierung unter der Führung Netanjahus mit Beteiligung von radikalen Vertretern jener Siedler, die der israelische Historiker Moshe Zimmermann mit dem biblischen Satz in Verbindung bringt, für das Volk, das sie zu vertreten beanspruchen, müsse gelten: » […] es wohnt für sich und rechnet sich nicht zu den Völkern«; und das bedeute: »auf die Goijm wird kein Wert gelegt«.[3]
Läuft das nicht darauf hinaus, unter Berufung auf das Alte Testament völlige Nachbarlosigkeit zum anti-politischen Programm zu erheben bzw. sich überhaupt nicht mehr politisch zu irgendwelchen Nachbarn verhalten zu wollen? Und das nach vielen Jahren, in denen die Juden selbst ein Leben ohne Nachbarn hatten führen müssen? So hatte Rabbi J. Prinz das spezifisch jüdische »Los« geradezu definiert: »nachbarlos zu sein« bzw. geworden zu sein, nachdem man einmal Nachbarn bzw. Mitbürger gehabt zu haben meinte, von denen man dann im Dritten Reich verraten worden war. Hätte daraus nicht die Suche nach wirklicher, guter und beständiger Nachbarschaft hervorgehen müssen – im Verzicht auf die im Grunde a-politische Illusion, in Zukunft auch ganz ohne sie auskommen zu können? Waren Rabin und Arafat im Osloer Friedensprozess nicht schon ein gutes Stück in die Richtung solcher Nachbarschaft vorangekommen? Wirken die Radikalen in der amtierenden israelischen Regierung nicht entschlossen darauf hin, den ganzen Staat in die genau entgegengesetzte Richtung zu bewegen? Muss das nicht nur Folge haben, ihn selbst nun umso mehr mit einer schweren Hypothek der Vertreibung, womöglich mit genozidalen Konsequenzen, zu belasten, als man heute keine geo-politische Naivität mehr für sich in Anspruch nehmen kann, die nicht wenige Zionisten zunächst hatte ›übersehen‹ lassen, dass in Palästina ja schon Menschen wohnten?
Wer heute den Gaza-Streifen räumen lassen und die dort noch immer Überlebenden durch Internierung in Lagern über kurz oder lang zur »freiwilligen Emigration« zwingen will, um sich anschließend ihr Land anzueignen, wird keine solche Naivität mehr für sich geltend machen können, sondern muss wissen, dass er auf diese Weise nur die nächste Runde einer radikalen Verfeindung einläuten kann, die die Zukunft der eigenen Kinder und Kindeskinder auf beiden Seiten im Vorhinein in Geiselhaft nimmt. Bartov spricht angesichts der absehbaren Folgen von einer »zweiten Nakba«, die sich Israel nun zu Schulden kommen lasse. Dabei hütet er sich allerdings vor Dramatisierungen der ohnehin katastrophalen Lage, geht es ihm doch um das Ausloten einer residualen Hoffnung auf einen Ausweg für alle Beteiligten. Dabei weiß er, dass die gängige Rede von ›zwei Seiten‹ des Konflikts eine grobe und u. U. irreführende Vereinfachung darstellt. Als Gründungsmitglied der auf das Jahr 1977 zurückgehenden israelischen Friedensbewegung Schalom Achschaw ist er sich – genauso wie ungezählte Palästinenser – dessen bewusst, dass die jeweils andere Seite in guten nachbarschaftlichen Verhältnissen in Frieden leben will und sich genau darin von den Radikalen auf der jeweils eigenen Seite verraten sehen muss, die sich ganz dem Geist der Feindschaft ergeben haben und ihren Landsleuten keinen Ausweg aus ihm erlauben wollen.
Seinem Buch hat Bartov nach dem Hamas-Terroranschlag vom 7.10.2023 ein an deutschsprachige Leser adressiertes Vorwort hinzugefügt, das erklärt, wie historische Erinnerung zum Verständnis unserer Gegenwart beitragen kann; und zwar im Zuge eines komparativen Verfahrens, das riskiert, auf den ersten Blick Unvergleichbares wie diverse im Osten Europas verübte Genozide, den Holocaust und das gegenwärtige israelisch-palästinensische Missverhältnis in Beziehung zu setzen, um im anscheinend Unvergleichbaren Gemeinsames zu entdecken. Dabei handelt es sich um das Verhältnis insbesondere aller damals und heute beteiligten Staaten zu deren eigener Gewaltgeschichte. Deren Nachwirkungen hatten vielfach zur Folge, dass es nahezu unmöglich wurde, sich überhaupt zu ihr zu äußern, ohne sogleich in einen radikalen Streit zu geraten, in dem man sich nur noch eines wechselseitig bestätigt, nämlich nichts mehr miteinander gemeinsam zu haben – bis auf eben dies: sich genau das gegenseitig ständig an den Kopf zu werfen (sofern man überhaupt noch in irgendeine Verbindung miteinander tritt, die ›kommunikativ‹ genannt zu werden verdiente).
Jeder Versuch, Sachverhalte wie die israelische Staatsgründung und deren Kehrseite, die Nakba, miteinander in Verbindung zu bringen, droht in dieser Lage von einer Vorgeschichte massivster Verletzungen vereinnahmt zu werden. Wer wie derzeit eine »kleine Minderheit« in Israel nicht nur von einer Seite aus an sie erinnert, riskiert dort gegenwärtig, so Bartov, als »linksextrem« und als Verräter an der nationalen Sache gebrandmarkt zu werden. In Palästina macht man ähnliche Erfahrungen, wenn man den Versuch unternimmt, für die jüdisch-israelische Gegenseite auch nur das mindeste Verständnis aufzubringen. Bartov bietet in dieser Lage ein Verfahren der Werbung für geduldiges Zuhören auf, in dem man sich wenigstens erzählen lässt, was der jeweils eigenen Geschichte scheinbar vollständig zuwiderläuft und sie geradezu negiert. So gesehen liegt ihm alles an der Anbahnung einer ersten, dialogischen Geste des Friedens, die durch das immer weiter sich vertiefende jüdisch-palästinensische Zerwürfnis zugleich täglich abwegiger zu werden scheint. Müssten sich dessen ungeachtet aber nicht im Sinn einer solchen Geste virtuell jetzt schon die Kinder und Kindeskinder aller Seiten einig sein? Könnten sie sich politisch artikulieren, würden sie dann nicht an alle Konfliktparteien adressiert sagen: »Wir wollen nicht die im Voraus zur Fortsetzung eurer Gewaltgeschichte Verurteilten sein«?
In dieser zukunftsweisenden Perspektive bezieht Bartov wie einige andere, allen voran M. Zimmermann und S. Stein, T. Segev, R. Leshem und weitere Erklärer der gegenwärtig ausweglos erscheinenden Situation, als harter Kritiker der amtierenden israelischen Regierung Position. Wieder andere gehen so weit, von den Deutschen zu fordern, die seit einigen Jahren viel zitierte Staatsraison mit Rücksicht auf Israel keinesfalls als bedingungslose Konformität mit den Vorhaben der dortigen Regierung auszulegen, sondern ihrer repressiven Besatzungspolitik jegliche Unterstützung zu entziehen. Bartov spricht, offenbar in diesem Sinne, deutlich von einer durch nichts zu rechtfertigenden, also auch nicht von deutscher Seite zu billigenden Fortsetzung einer Politik der ethnischen »Säuberung«, der Vertreibung und der Annexion, um ihr seinen Versuch entgegenzusetzen, auf der »Suche nach einem Zuhause«, die uns alle verbinde, zunächst wenigstens mit den Erzählungen der Anderen zu leben.
Mit ›uns‹ sind in erster Linie Juden und Palästinenser gemeint. Die deutschen Adressaten des Buches dürften sich jedoch auch angesprochen fühlen. Nach dem Desaster des Nationalsozialismus musste es der innige Wunsch aller sein, die sich wirklich mit ihm auseinandergesetzt hatten, dass Juden in Israel eine rechtsstaatlich geschützte Form ihres Zusammenlebens in guter Nachbarschaft finden, ohne dabei sofort in den Sog einer Gewalt zu geraten, die die europäische Geschichte der Ausbildung von Nationalstaaten immer wieder mit sich gebracht hat. Waren die sich als exiliert begreifenden Juden in ihrer Diaspora zuvor keine Nation, sollten sie es etwa nach ›1945‹ um diesen Preis werden müssen?
Daran war noch nicht zu denken, solange nur klar war, dass die 1948 erfolgte Gründung des Staates Israel die unumgängliche Antwort auf den vom Nationalsozialismus zu verantwortenden Versuch darstellen musste, die europäischen Juden (und darüber hinaus womöglich alle) zu vernichten. Ungeachtet viel weiter zurückreichender zionistischer Ideen sowie früherer Erfahrungen des Verdrängtwerdens aus Europa musste nach ›1945‹ – und muss weiterhin – ein enger, auch von Bartov betonter Zusammenhang zwischen der Shoah und der Staatsgründung bestehen. Offizielle Staatsgäste besuchen die Gedenkstätte Yad Vashem deshalb regelmäßig, und bei der entsprechenden Gelegenheit konnte Netanjahu wiederholt betonen, der jüdische Staat werde »›alles‹ [!] tun […], um einen neuen Holocaust zu verhindern«. Hier sieht Bartov allerdings die Gefahr, dass sich Israel selbst in eine »unentrinnbare Falle« begibt, »aus der es sich hatte befreien wollen«: In die Falle, sich in einer genozidalen Welt von immer neuen Wiederholungen Desselben tödlich bedroht zu sehen. Und er erinnert an den Einspruch Y. Elkanas dagegen, »jungen Israelis immer wieder ein[zu]hämmer[n], der Holocaust dürfe sich nicht wiederholen«, um ihnen auf diese Weise »die Lizenz« zu erteilen, »alle Bedrohungen als existenziell und alle Gegner als potenzielle Nazis zu betrachten«, die dann auch mit »allen« Mitteln zu bekämpfen wären – wie jetzt die terroristische Hamas bis zum »endgültigen Sieg«, den Netanjahu tatsächlich in Aussicht gestellt hat.
Nicht nur macht man es sich so mit den gegenwärtigen Gegnern bzw. Feinden zu einfach, die man auf diese Weise über einen Kamm schert; man vergisst womöglich auch die fatale Kehrseite, die die Negation der Diaspora bis heute hat. Für Bartov ist es nicht zu bestreiten, dass die Nakba als diese Seite der vom NS-Mordprogramm hergeleiteten Staatsgründung zu begreifen ist, in die die anfangs geopolitisch teils naive, teils aber auch sehr aggressive, nach seinen Worten »siedlerkolonialistische zionistische Bewegung« schließlich mündete – mit dem Erfolg einer Auslöschung von ca. 400 Dörfern, in denen sich dann teilweise Juden ansiedeln konnten. Weil sich aber fast niemand diesem integralen Zusammenhang stelle, drohe sich das »Nie-Wieder«, das viele deutsche Juden und mit ihnen solidarisch viele nicht-jüdische Deutsche skandieren, für viele Palästinenser in das »Wieder-und-Wieder« einer nicht endenden Nakba hinein fortzusetzen.
Die normative Konsequenz, die er daraus zieht, besagt, dass sich jede Nation »die dunkleren Episoden ihrer Geschichte« eingestehen muss, statt die Erinnerung immer wieder »voll bewaffnet aus den Tiefen der Vergangenheit« sich erheben zu lassen. So spricht er sich für eine gleichsam entwaffnete Erinnerung aus, die endlich das den Palästinensern angetane Unrecht anerkennen soll – ohne zuerst danach zu fragen, ob wenigstens einige von ihnen ihrerseits auf diese Weise je ihren jüdischen Nachbarn entgegenkommen werden (bzw. ob sie das bereits tun). Sich die auf den ersten Blick miteinander nicht zu vereinbarenden Geschichten aller verfeindeten Seiten anzuhören, ist das nicht schon eine erste, allerdings ganz einseitige Geste friedlicher Anerkennung, noch bevor man zu irgendwelchen Geltungsansprüchen Stellung genommen hat?
Wo Bartov den Blick in die geschichtlichen Verhältnisse zwischen Polen, der Ukraine sowie einer Vielzahl von Ethnien einerseits und dem sog. Dritten Reich andererseits richtet, wird im Grunde das Gleiche deutlich: Wer sich derartiger Erinnerung nicht stellt, beschwört eine gespenstische Wiederholung des infolgedessen Verdrängten herauf. Im Fall dieser Verhältnisse geht es um eine gewisse Mitverstrickung in die bis heute fortwirkende Vernichtungspolitik der Nazis. Die auch von so unterschiedlichen Autoren wie Snyder, Littell, Kappeler, Schlögel u.v.a.m. betriebene Blickwendung nach Osteuropa, wo ungefähr die Hälfte der europaweit ermordeten Juden mit Hilfe ansässiger Bevölkerung umgebracht wurde – so dass Bartov von einem keineswegs »industriellen«, sondern »kommunalen Genozid« sprechen kann –, entlastet hier niemanden von einer ohnehin inexistenten, angeblich sogar erblichen Kollektivschuld, die v.a. von rechten Kreisen nur immer aufs Neue herbeizitiert wird, um sich jeglicher historischen Verantwortung zu entziehen. Das ist gänzlich unakzeptabel, weil die Geschichte für die Gegenwart Entscheidendes lehrt, nämlich wie fortgesetzte Diskriminierung von Nächsten und Mitbürgerinnen schließlich desaströse Folgen haben kann und u. U. vielleicht haben muss.[4] Man muss sich an die entsprechende Gewaltvorgeschichte erinnern, weil nur so auch bewusst bleiben kann, worauf akzeptable, in ihren inneren und nachbarschaftlichen Verhältnissen anzuerkennende Staatlichkeit beruht.
Mit Recht insistiert Bartov darauf, dass man die Shoah nicht auf ein scheinbar ›gesichtsloses‹, völlig anonymes Gewaltgeschehen reduzieren sollte (worauf sie sich selbst in Auschwitz nicht reduzieren konnte). Vielfach waren es Nachbarn, die zuvor mit Juden irgendwie »koexistiert« hatten, ihnen dann aber auf alle erdenklichen Arten und Weisen von Angesicht zu Angesicht Gewalt angetan haben. Im gleichsam überkreuzten Blick nach Osten (von ›uns‹ aus) und nach Süden in die israelisch-palästinensische Gegenwart lässt Bartov erkennbar werden, wie sich die seinerzeit zerstörte Nachbarschaftlichkeit noch heute in unversöhnliche Erinnerungen und Geschichten hinein auswirkt. Doch darin zeichnet sich wie ein Hoffnungsschimmer auch die Idee ab, wie gute politische Nachbarschaft in ihrem anhaltenden Bedrohtsein durch abgründige Gewalt auf allen, persönlichen, ethnischen, religiösen, rechtlichen und transnationalen Ebenen möglich sein könnte: Durch die Bereitschaft, sich zuerstund vorbehaltlos sagen zu lassen, was Andere auf für sie unerträgliche Weise erfahren haben, und für Andere, ob ›nahestehend‹, wie auch immer verwandt oder fremd, aktiv einzuspringen, wenn ihnen Unerträgliches widerfährt, typischerweise einsetzend mit Formen der Diskriminierung, die die politischen Verhältnisse vergiftet. In diesen beiden Hinsichten gilt es politisch-geschichtliche Nachbarschaft neu zu denken. Auch das lässt sich als Gemeinsames im Vergleich scheinbar sehr weit voneinander entfernter Gewaltgeschichten erkennen, zu denen es im Zentrum und im Osten Europas sowie im Nahen Osten gekommen ist.
Um aus Bartovs Buch wenigstens ansatzweise solche Lehren ziehen zu können, bedürfen wir allerdings keiner vorherigen Nachhilfe seitens derer, die meinen, es gehe darum, »[to] free Palestine from German guilt« und es endlich in der nach ihrer Ansicht allein angemessenen Dekolonialisierungsperspektive zu sehen, wie sie u.a. von A. D. Moses und A. Mbembe verteidigt wird. Diese Problematik liegt wie gesagt längst nicht mehr in einer angeblich unendlich nachwirkenden Schuld, sondern darin, den inneren geschichtlichen Zusammenhang zwischen der historisch beispiellosen und willkürlichen Entrechtung und Entwürdigung von Millionen einerseits und den aktuellen Grundlagen jeder akzeptablen Staatlichkeit andererseits zu begreifen. Dieser Zusammenhang kann nur deutlich werden, wenn der jeweils betroffene Staat die in seinem Namen ausgerechnet gegen die Schwächsten verübte Gewalt eingesteht und darauf das glaubhafte Versprechen gründet, sich dieser Gewalt zukünftig zu widersetzen. Wenn man behauptet, das müsse auch anderswo gelten, weder in Palästina noch in Israel, weder in Polen, in der Ukraine oder in Russland werde man darum herumkommen, sich dem zu stellen, bedeutet das nicht, an sich ›unvergleichliche‹ Pogrome, Vernichtungspolitiken, Genozide und Kriege ohne Weiteres auf eine Stufe zu stellen. Am Paradox des Vergleichs von Unvergleichlichem kommen wir jedoch nicht vorbei, wenn zu ermitteln ist, was etwa die Verstrickung in Verbrechen der Wehrmacht im europäischen Osten für Deutschland oder für europäische Nachbarländer gegenwärtig bedeutet und welche Folgen aktuelle sog. ethnische, möglicherweise genozidale »Säuberungen«, Vertreibungen und Annexionen für die Zukunft der davon betroffenen verfeindeten Parteien haben werden. In jedem einzelnen Fall besteht ein integraler Zusammenhang zwischen gewaltsam zerstörter und wenn überhaupt, dann nur im Geist des Eingeständnisses für die Zukunft wiederherzustellender Nachbarschaftlichkeit.
Was zwischen Juden und Palästinensern auf fatale Weise in immer neue Vernichtungsdrohungen und in genozidales Verhalten im Namen ›endgültiger‹ Siege über den Feind zu münden droht, läuft darauf hinaus, diesen Geist des Eingeständnisses ganz und gar zu ruinieren – wie es unter ganz anderen Umständen auch im Dritten Reich und unter dessen brutalster Regie im Osten Europas geschehen ist. Bartov legt eindrücklich nahe, wie heutige Rückbesinnung darauf Auswege versprechen könnte aus fortwährenden Gewaltandrohungen, in denen die Feinde schließlich ganz voneinander abhängig zu werden drohen. Was haben sie am Ende noch anderes gemeinsam als das unauflösliche Missverhältnis derer, die nichts mehr miteinander teilen und sich menschlich zutiefst fremd zu sein behaupten?
In radikalisierter Verfeindung, die schließlich keinerlei Eingeständnis mehr zulässt, selbst Anteil an ihr zu haben, zeichnet sich am Ende als tiefste Gemeinsamkeit der Feinde ab, sich in gar nichts mehr miteinander verbunden zu wissen, nicht einmal mit Blick auf die Zukunft der Kindeskinder, die beide Seiten allesamt vorweg zur Fortsetzung der gleichen Gewaltgeschichte verurteilen. Wenigstens darin wären sie dann auf jeden Fall eines Sinnes, müssten aber jeglichen Anspruch einbüßen, in ihrer unendlichen Selbstgerechtigkeit der Zukunft ihrer Nachkommen im Geringsten gerecht zu werden.
Wenn das zutrifft, sind es die radikalen Feinde auf beiden Seiten, die ihr eigenes Land und Volk an die vergiftete Gewalt verraten, von der sie, mit wie ›guten Gründen‹ subjektiv auch immer, partout nicht ablassen wollen. So gesehen trägt Bartov zur Entgiftung bei; und es wäre zu wünschen, dass es ihm von palästinensischer Seite mit Blick auf deren jüdisch-israelische Opfer gleichgetan wird. Das wiederum wird nur möglich sein im Geist eines Zuhörens, das nicht bereits das bloße Benennen und Nebeneinanderstellen dessen, was auf verschiedenen Seiten vorgefallen ist, skandalisiert, wie es jetzt selbst an deutschen Universitäten allenthalben zu beobachten ist. Wer aber dazu beiträgt, erweist einer demokratischen Kultur einen Bärendienst, die damit steht und fällt, dass sich radikaler Dissens ›in der Sache‹ zuerst einmal wenigstens zeigen und artikulieren darf, bevor man überhaupt daran denken kann, eine Auseinandersetzung mit Worten und Argumenten aufnehmen zu können. So gesehen muss sich auch ein bloß diskurstheoretisches Demokratieverständnis als defizitär erweisen, das für die Schwierigkeiten, aus tiefgreifenden Gewaltgeschichten heraus überhaupt in eine Auseinandersetzung mit Anderen eintreten zu können, wenig Verständnis aufbringt. Vor dem verständigungsorientierten, womöglich vernünftig zu führenden Diskurs liegt allemal das entwaffnete, responsive Zuhören, das sich sagen lässt, was unannehmbar erscheint, allem voran eigene, anhaltende Verstrickung in die Anderen angetane Gewalt. Wie Bartov zeigt, lassen sich in solcher Responsivität Aussichten einer künftigen guten Nachbarschaftlichkeit wenigstens erahnen.
[1] Vgl. Vf. (Hg.), Geschichtskritik nach ›1945‹. Aktualität und Stimmenvielfalt, Hamburg 2023.
[2] O. Bartov, Genozid, Holocaust und Israel:Palästina. Geschichte im Selbstzeugnis, Berlin 2025.
[3] M. Zimmermann, Niemals Frieden? Israel am Scheideweg, Berlin 22024, 136, 168.
[4] Vgl. Vf., ›Die‹ Gewalt und ›wir‹. Sozialphilosophische Beiträge zur Geschichte, zu Widerfahrnissen und aktuellen Brennpunkten, Baden-Baden 2024, Kap. XVII.