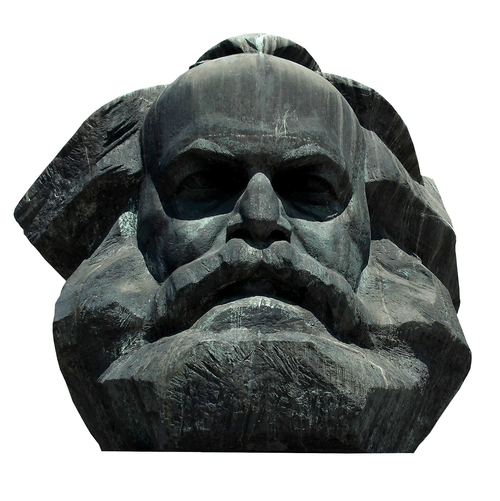
Produktionsverhältnisse, Produktivkräfte, Proletariat: Präfaktisch denken mit Marx
von Eva Bockenheimer (Köln)
„Fakten, Fakten, Fakten“ – mit diesem Werbespruch buhlte ein großes deutsches Nachrichtenmagazin in den 1990er Jahren um die Leserschaft. Dieser Werbespruch war so erfolgreich, dass er zu einer Art geflügeltem Wort wurde und sogar Eingang in die Satire fand. Sogenannte „Fakten“ stehen immer noch hoch im Kurs und werden kritisch gegen postfaktische Meinungsmache ins Feld geführt. Auch Karl Marx hat die Fakten seiner Zeit intensiv studiert und selbst statistische Daten gesammelt, z.B. über die Weltwirtschaftskrise von 1857. Eine marxistische Analyse der Gegenwart muss also selbstverständlich informiert sein über die bestehenden Fakten und diese gegebenenfalls auch gegen das Postfaktische ins Feld führen. Aber Marx wusste auch, dass alle Wissenschaft überflüssig wäre, „wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen“ (MEW 25, 825). Fakten allein, nicht zuletzt, weil sie meist widersprüchlich sind, lassen uns also noch nichts begreifen – dazu müssen wir den inneren Zusammenhang dieser Fakten erfassen. Haben wir den Zusammenhang begriffen, erscheinen nicht nur die Fakten oft in einem ganz anderen Licht, sondern auch die postfaktischen Gefühlslagen, deren Ursache wir dann vielleicht besser verstehen können. Das rechtfertigt zwar nicht die oft reaktionären Forderungen, die auf Grundlage postfaktischer Affekte gestellt werden. Aber es kann in manchen Fällen – sofern das Postfaktische nicht ohnehin bloß der Machtdemonstration dient – vielleicht ein Gespräch eröffnen über die wahren Ursachen für den postfaktischen Unmut und die bestehende Wut dorthin lenken, wo sie eigentlich hingehört.
Fakten für sich genommen – ohne eine Analyse ihres inneren Zusammenhangs – enthalten nicht nur den Mangel, dass sie bloß die Ebene der Erscheinungsformen betreffen. Sie haben noch einen weiteren Nachteil: Wenn wir sie zur Kenntnis nehmen, sind sie bereits eingetreten. Empirische Studien sind also immer auf Vergangenes orientiert, das bereits zum „Fakt“ geworden ist. Ganz anderes sieht es aus, wenn wir uns auf den inneren Zusammenhang konzentrieren, wie Marx das getan hat. Denn der innere Zusammenhang ist nichts anderes als die begriffene Notwendigkeit der losen Fakten und enthält deshalb nicht nur die Vergangenheit, sondern auch in Keimform bereits die zukünftige Entwicklung. Angelehnt an Formulierungen von Marx kann man sagen: Die Gegenwart enthält nicht nur die Muttermale der Vergangenheit, sondern geht auch schwanger mit der Zukunft. Das heißt nicht, dass wir im Sinne eines Determinismus zwangsläufig die Zukunft aus der Gegenwart ableiten können. Aber es bedeutet, dass wir die innere Logik und Entwicklung der Gegenwart begreifen können. Gelingt uns das, können wir verstehen, welche Tendenzen der Gegenwart es politisch aufzugreifen gilt, wenn unser Ziel eine freie Gesellschaft ist.
In diesem Sinne ist Marx‘ Analyse des Kapitalismus immer auch „präfaktisch“: Marx erklärt nicht nur die gegebenen „Fakten“, sondern er fasst die innere Logik und Entwicklung des Kapitalismus in Begriffe und zeigt, an welchen inneren Widersprüchen er zugrunde gehen wird. Das heißt selbstverständlich nicht, dass der Kapitalismus von selbst, ohne unser bewusstes Zutun aufgrund seiner ihm eigenen Dialektik in den Sozialismus übergehen wird – er kann auch von selbst in der Barbarei enden oder die Menschheit mit ihm gemeinsam untergehen. Aber ewig bestehen – so viel ist sicher – kann er nicht. Das begreifen wir, wenn wir verstehen, wie er geworden ist und wohin er sich mit Notwendigkeit, aufgrund seiner ihm eigenen Gesetze und Widersprüche, entwickelt. Das in diesem Sinne „präfaktische“, die Zusammenhänge begreifende Denken hat Marx befähigt, geradezu visionär wesentliche Entwicklungen vorauszusagen.
Im Vorwort zu seiner Schrift „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ von 1859 formuliert Karl Marx in einer berühmten Passage in aller Kürze das allgemeine Resultat seiner Erforschung der politischen Ökonomie, das ihm nach eigener Aussage fortan zum Leitfaden seiner Studien diente. Darin heißt es:
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. (…) Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind.“ (MEW 13, S. 8f).
Wenn wir heute die kapitalistischen Produktionsverhältnisse im Anschluss an Marx‘ eigenen Leitfaden analysieren möchten, um die progressiven Entwicklungstendenzen der Gegenwart „präfaktisch“ herauszuarbeiten, dann müssen wir uns die Fragen stellen: Wo brüten wir in der Gegenwart die materiellen Bedingungen für eine neue Gesellschaft aus? Oder anders formuliert: Wo entwickeln wir im Schoße der jetzigen Gesellschaft die Produktivkräfte, die es uns ermöglichen könnten, neue Produktionsverhältnisse an die Stelle der alten zu setzen? In aktuellen Debatten über die Zukunft der Arbeit und den gesellschaftlichen Wandel setzen demokratische und emanzipatorische Ansätze häufig Hoffnung in technische Entwicklungen wie die Automatisierung und insbesondere die Digitalisierung der Arbeit, in der Annahme, dass neue Produktionsmittel eine materielle Voraussetzung für neue Produktionsverhältnisse darstellen, z.B. weil sie Menschen ermöglichen, die notwendige Arbeitszeit drastisch zu reduzieren und Güter ohne weitere Kosten zu reproduzieren. Zwar lassen sich solche Argumente auch bei Marx finden. Der Marxsche Begriff Produktivkräfte bezieht sich allerdings nicht nur auf die Produktionsmittel, d.h. auf technische Errungenschaften der Menschen, sondern er bezeichnet ganz wesentlich die unmittelbaren Fähigkeiten der arbeitenden Menschen selbst. In der Analyse der Entwicklung der Produktivkräfte der Gegenwart sollten wir uns daher nicht auf die Produktionsmittel beschränken.
Eine Analyse, die konsequent die gewachsenen Fähigkeiten der Menschen selbst in den Mittelpunkt rückt, liefert Stephan Siemens in seinem Buch Das unternehmerische Wir. Diese Analyse zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Tradition von Marx neben der zunehmenden Ausbeutung, gesundheitlichen Belastung und Prekarisierung in modernen Arbeitsverhältnissen zugleich deutlich macht, dass die lohnabhängig Beschäftigten (das heutige Proletariat) aktuell in der Arbeit eine neue Fähigkeit– eine Produktivkraft – entwickelt haben und weiterentwickeln, die sehr nützlich, wenn nicht sogar notwendig ist, damit die Menschen die Produktion in Zukunft anders als kapitalistisch organisieren können. Die neue Produktivkraft besteht nach Siemens darin, dass die arbeitenden Menschen die Fähigkeit entwickelt haben, sich in der Arbeit mit dem gesellschaftlichen Sinn ihrer Arbeit auseinanderzusetzen. Sie sind immer mehr in der Lage selbstbewusst gesellschaftlich zu produzieren und ihre Kooperation selbst zu organisieren.
Die Unternehmen passen sich an diese neue produktive Fähigkeit an, indem sie den lohnabhängig Beschäftigten mehr und mehr die Unternehmerfunktionen übergeben. Allerdings geben sie die Unternehmerfunktionen nicht ohne weiteres ab, sondern steuern die Beschäftigten dabei indirekt, durch bestimmte Rahmenbedingungen. Beispielsweise organisieren sie intern die Zusammenarbeit als Wettbewerb (Coopetition) und bilden durch Profitcenter, Business-Units oder teilautonome Unternehmenseinheiten innerhalb des Unternehmens oder Konzerns Marktverhältnisse ab, sodass die Beschäftigten in den Teams ständig ihre Profitabilität unter Beweis stellen müssen. Innerhalb dieser vom Unternehmen geschaffenen „Umwelt“ sollen die Beschäftigten dann in selbstorganisierten Teams ihre Zusammenarbeit selbst koordinieren, über Kosten und Profite nachdenken, die Effizienz und Effektivität ihrer Arbeit im Blick behalten und selbst Antworten auf die Anforderungen der Kund*innen, Klient*innen und Kolleg*innen finden.
Diese Entwicklung wird in soziologischen Studien zumeist negativ bewertet, da sich die Beschäftigten dadurch scheinbar ganz der Unternehmerlogik unterwerfen. Als Marxist erinnert Siemens jedoch daran, dass die Unternehmerfunktionen einst die eigentlich produktiven Funktionen des Kapitalisten waren, die wesentlich darin bestehen, gesellschaftliche Produktion zu organisieren. Tatsächlich verlieren die Kapitalisten nach Marx und Engels im Laufe der kapitalistischen Produktionsweise jegliche produktive gesellschaftliche Funktion bereits, wenn sie die Unternehmerfunktionen an Manager abgeben, die letztlich nichts anderes sind als hochbezahlte, bessergestellte Proletarier. (MEW 19, 288) Denn damit reduzieren sie ihre eigene Funktion auf das Einstreichen der Dividende und es wird umso offensichtlicher, dass die Eigentumsverhältnisse zu den Produktionsverhältnissen in Widerspruch stehen. (MEW 25, S. 400) Wenn nun das Management heute mehr und mehr Unternehmerfunktionen an die kooperierenden Beschäftigten abgibt, ist das eine Weiterführung dieser Entwicklung und nur konsequent, denn schließlich wissen die Beschäftigten tatsächlich am besten, wie die Arbeit sinnvoll organisiert werden kann. Wie für die Manager so hat diese neue Aufgabe auch für die Beschäftigten einen Doppelcharakter: Auf der einen Seite unterwerfen sie sich damit scheinbar selbst ganz der Kapitalfunktion, Profit zu erwirtschaften. Aber auf der anderen Seite sind diese Funktionen gesellschaftlich sinnvoll und produktiv (MEW 25, 397). Im Kapitalismus ist die Profitabilität das Kriterium nach dem entschieden wird, ob eine bestimmte Tätigkeit produktiv ist. Es ist sicher ein sehr beschränktes Kriterium, da es Produktivität unmittelbar mit Profitabilität gleichsetzt, worüber sich Marx gerne mokiert. (Vgl. MEW 26.1, S. 368f.) Dennoch ist der Profit eben die Form, über die im Kapitalismus die Gesellschaftlichkeit der Produktion reflektiert wird: Durch die Orientierung am Markt und am Profit ermittelt der Unternehmer sowohl, ob das Produkt des eigenen Unternehmens gesellschaftlich nützlich als auch, ob er es absetzen kann. Um erfolgreich zu sein, muss er sich ständig bemühen, die Formen der Zusammenarbeit, die Produktionsmittel, den Vertrieb usw. zu verbessern. Indem die Beschäftigten sich diese unternehmerischen Funktionen aneignen, eignen sie sich zugleich den gesellschaftlichen Charakter ihrer eigenen Arbeit an – wenn auch in der beschränkten Form der Profitabilität.
Die Fähigkeit, die Zusammenarbeit effizient und effektiv zu gestalten und über den gesellschaftlichen Sinn der eigenen Arbeit nachzudenken ist nützlich für die Menschen und wird es auch immer sein. Obwohl sie im Kapitalismus wesentlich zur Folge hat, dass die Arbeit weiter intensiviert wird und Menschen aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen werden, könnte uns diese Fähigkeit in einer zukünftigen Gesellschaft helfen, die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu reduzieren und uns somit freie Zeit schenken. Weil diese Fähigkeit produktiv ist, ist es auch begrüßenswert, wenn Beschäftigte sie aktuell weiterentwickeln und sich aneignen können. Nur weil ihnen ihre neue produktive Kraft noch unbewusst ist, erscheint sie als seine fremde Macht.
Die ökologische und humanitäre Krise, die der Kapitalismus produziert zwingt uns dazu, uns mit dieser kapitalistischen Borniertheit auseinanderzusetzen. Im Kapitalismus kann die ökologische und soziale Wirkung der Produkte unserer Arbeit und ihres Produktionsprozesses nur soweit berücksichtigt werden wie dadurch die Gewinne nicht beeinträchtigt werden. Aktuell fangen immer mehr Beschäftigte an, sich in ihrer Arbeit mit dieser Beschränktheit auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zum echten Unternehmer können sie den Unterschied zwischen Produktivität und Profitabilität reflektieren, weil für sie – anders als für den Unternehmer – der Profit kein Selbstzweck ist. Die Beschäftigten machen dabei die Erfahrung, dass sie eigentlich nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten vernünftiger produzieren könnten, dass sie aber durch die kapitalistische Produktionsweise daran gehindert werden. Dadurch erfahren sie in ihrer eigenen Arbeit die Differenz zwischen Produktivität und Profitabilität. Das kann eine echte Zerreißprobe sein und stellt die Qualität der eigenen Arbeit infrage. Während der Kapitalist seine Existenz der Beschränkung auf den Profit verdankt und daher als Kapitalist (wenn auch nicht als Mensch) kein Interesse daran hat, diese Verhältnisse zu überwinden, werden die Beschäftigten den Profitmaßstab abschaffen wollen, sobald sie verstehen, dass er zu einer Fessel für die neuen Produktivkräfte geworden ist.
Kurz: Die Fähigkeit, alle unsere Tätigkeiten auf die gesellschaftliche Arbeit als Ganze zu beziehen und unsere Kooperationsformen selbst zu organisieren, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine neue Gesellschaft. Es ist deshalb sehr begrüßenswert, dass die Beschäftigten sich aktuell die Fähigkeit, gesellschaftlich zu produzieren, gemeinsam aneignen. Wenn wir die gegenwärtigen Veränderungen in der Arbeit unter diesem Aspekt betrachten, sehen wir nicht in erster Linie den Verfall bürgerlicher Werte und Errungenschaften, sondern etwas Neues: die Entwicklung einer neuen produktiven Kraft, die die Beschäftigten bisher noch nicht vollends entfalten können, weil sie innerhalb der Grenzen privater, profitorientierter Unternehmen kooperieren müssen. Der Widerspruch der gewachsenen Produktivkräfte und der bestehenden Produktions- und Eigentumsverhältnisse wird damit immer schreiender.
Selbstverständlich ist das nur ein Aspekt der gegenwärtigen Entwicklung, aber aus einer marxistischen Perspektive ist es ein entscheidender. Man kann hoffen, dass die bewusste Entwicklung dieser neuen produktiven Kraft uns neben anderen Entwicklungen ermöglichen wird, eine Gesellschaftsformation hervorzubringen, in der wir gemeinsam unsere Wünsche und Bedürfnisse befriedigen und unsere Produktionsverhältnisse beherrschen können, statt von ihnen beherrscht zu werden.
Eins ist aber sicher: Das im genannten Sinne präfaktische Denken von Karl Marx ermöglicht es, solche materiellen Entwicklungstendenzen in der Gegenwart überhaupt erkennen und über ihre Konsequenzen diskutieren zu können. Nicht zuletzt deshalb lohnt es sich auch heute noch, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen.
Eva Bockenheimer promovierte 2011 an der Ruhr-Universität Bochum mit einer Arbeit über Hegels Familien- und Geschlechtertheorie (Meiner 2013).

