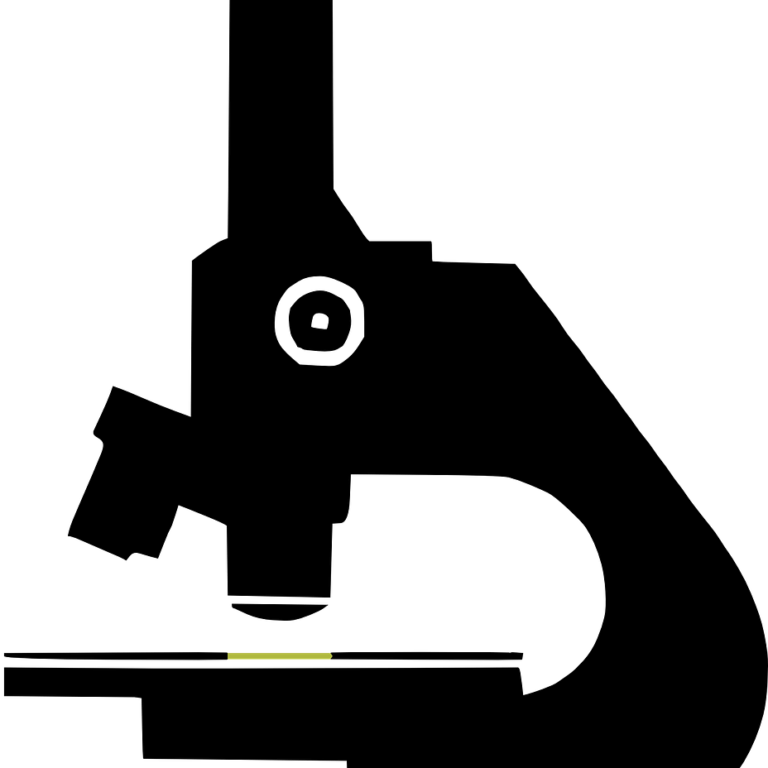„Ist das überhaupt noch ‚Ethik‘?“ – Nicht-philosophische Methoden in der interdisziplinären Medizinethik
von Marcel Mertz (Hannover)
Als ich damals – vor über 15 Jahren – meine erste Stelle als studentische Hilfskraft an einem Medizinethik-Institut antrat, beschlich mich rasch ein konsternierendes Gefühl. Ich arbeitete zwar an einem Institut mit der Bezeichnung „Ethik“, konnte aber kaum etwas wiedererkennen, was ich mit meinen bisherigen Semestern im Philosophiestudium mit „Ethik“ in Verbindung brachte, wie Beiträge zur Kritik oder Verteidigung verschiedener Moraltheorien, Analysen moralisch relevanter Begriffe oder schlicht die Frage danach, was auf Grundlage dieser oder jenes Ansatzes z.B. in der Medizin „moralisch richtig“ wäre. Meiner damaligen Auffassung nach forschten die Wissenschaftler*innen an diesem Institut zu „irgendetwas“ – was, vermochte ich zu der Zeit noch nicht so richtig zu fassen –, aber sicher nicht zu Ethik. Die Fragestellungen, Arbeitsweisen und damit letztlich auch die Methoden wirkten auf mich nämlich überhaupt nicht „philosophisch“.
Der Grund hierfür dürfte schlicht darin gelegen haben, dass es oft auch keine philosophischen Methoden waren (und auch heute oft nicht sind), und das Ziel der Forschung auch eher selten jenes war (und auch heute wohl eher selten ist), „typischen“ philosophischen Fragestellungen nachzugehen.
Doch wie kann das sein – „Ethik“ ist doch eine philosophische Disziplin? Diese Frage beantwortet man am besten wissenschaftssoziologisch: Wir sprechen hier von einer interdisziplinären Medizinethik, deren Institute im Allgemeinen an medizinischen oder biowissenschaftlichen Fakultäten beheimatet sind, nicht an den philosophisch-historischen. Die Angehörigen solcher Institute rekrutieren sich v.a. aus der Medizin und den Pflegewissenschaften, aber auch aus den Geschichts-, Sozial- und Rechtswissenschaften; Philosophie ist hier nur eine Disziplin unter anderen. Ein Großteil der Forschung an solchen Instituten wird in Teams betrieben, bestehend aus Vertretern verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, und weniger in der sonst eher üblichen „Einzelkämpfer“-Mentalität der Philosophie. Dies alles hat zwangsläufig Einfluss darauf, was und wie geforscht wird.
Das „Wie“, also die Methoden einer Disziplin, sollte sich dabei bestenfalls an den Zielen orientieren, die sich eine Disziplin stellt – oder die auch von außen, z.B. von Vertretern einer bestimmten Praxis (wie Medizin oder Pflege), an sie herangetragen werden.
Das Ziel eines Großteils philosophischer Forschung dürfte die Theoriebildung im weitesten Sinne sein. Nun kann zwar nicht bestritten werden, dass es auch in der interdisziplinären Medizinethik Theoriebildung gibt – wohl keine wissenschaftliche Unternehmung kann und wird völlig darauf verzichten. Bei der Theoriebildung kommen auch in der Medizinethik u.a. philosophische Methoden wie Begriffsanalyse, explizite Argumentationsanalyse und -konstruktion oder die Verwendung bestehender philosophischer Theorien vor.
Jedoch zielt ein relevanter Teil medizinethischer Tätigkeit gerade nicht auf Theoriebildung ab. Das liegt daran, dass weitere Ziele die (Mit-)Erarbeitung von Empfehlungen, Leitlinien oder Entscheidungshilfen sein können, die sich am Ende nicht – oder zumindest nicht nur – an die wissenschaftliche Gemeinschaft richten, sondern für die Praktiker*innen in der Medizin oder Pflege etc. entwickelt werden. Die Fragestellungen, die hinter solcher Forschung oft stehen, sind keine philosophischen oder theoretischen, sondern letztlich praktische. Sie haben ihren Ausgangspunkt zuweilen auch nicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, sondern werden von denjenigen aufgeworfen, die mit ihnen in ihrem tatsächlichen Alltag konfrontiert werden.
Als konkretes Beispiel solcher Forschung soll im Folgenden die Leitlinienentwicklung betrachtet werden. Anhand dieses Beispiels kann anschaulich illustriert werden, dass (und warum) in der Medizinethik nicht nur philosophische Methoden eingesetzt werden können.
Ethische Leitlinien sollen Praktiker*innen im Gesundheitswesen Unterstützung und Orientierung in Bezug auf konkrete Themen geben, wie bspw. Umgang mit Demenzpatient*innen oder die Vermeidung von Über- und Unterversorgung am Krankenbett. Sie sind also nicht für ein ethisches Fachpublikum gedacht und müssen deshalb „laienverständlich“, praktisch bedeutsam (d.h. tatsächliche Probleme oder Sorgen aus der Praxis aufgreifend) und umsetzbar bzw. „befolgbar“ sein. D.h. u.a., dass sich eine Leitlinienentwicklung den Luxus nicht erlauben darf, von gegenwärtigen rechtlichen Regulierungen und praktischen Barrieren struktureller, institutioneller oder individueller Art abzusehen – was die philosophische Spekulation hingegen darf, oft auch muss und vielleicht sogar tlw. auch sollte, um auf eine „reine“ Analyse aus philosophisch-ethischer Perspektive fokussieren zu können –, wenngleich diese durchaus „in einem Nebensatz“ problematisiert werden dürfen. Dies kann aber nicht das Ziel einer Leitlinienentwicklung darstellen.
Auf methodischer Ebene hat dies drei Implikationen: A) es muss in Erfahrung gebracht werden, was in der Praxis Probleme oder Sorgen bereitet; B) es muss ein Überblick über die wissenschaftliche (ethische) Bearbeitung dieser (und weiterer) Probleme geschaffen werden; C) es muss sichergestellt werden können, dass die Praktiker*innen mit der dann erstellten Leitlinie umgehen können, sie akzeptieren und (daher) auch verwenden werden.
Für A) bedeutet dies bereits, dass philosophische Methoden nicht ausreichen werden. Keine Begriffs- oder Sprachanalyse, kein Gedankenexperiment, aber auch keine „Anwendung“ einer moralphilosophischen Theorie kann in Erfahrung zu bringen, was Menschen in einer Praxis tatsächlich „umtreibt“, welche strukturellen Problemlagen sich in einer konkreten Institution auftun oder welche z.T. auch „ungeschriebenen“ Regeln den Alltag von Praktiker*innen präformieren und ggf. auch deren Handlungsmöglichkeit einschränken. Derlei erfordert vielmehr empirische Methoden der Sozialwissenschaften (z.B. qualitative Interviewstudien), die auch (zunehmend) von der interdisziplinären Medizinethik verwendet werden). Dass es selten eine brauchbare Alternative ist, auf bestehende z.B. soziologische Forschung zurückgreifen, liegt darin begründet, dass die Forschungsinteressen einer Soziologie andere sind als jene einer Medizinethik; d.h., die empirische Forschung der etablierten Sozialwissenschaften liefert nicht zwingend jenen Einblick in die medizinische oder pflegerische Praxis, der medizinethisch benötigt wird. Auch aus diesem Grund hat sich in den letzten zwanzig Jahren eine empirische Medizinethik (empirical bioethics) gebildet, die selber empirische Forschung durchführt (vgl. Ives et al. 2018).
Hat man die erforderlichen empirischen Erkenntnisse, muss man für B) untersuchen, wie die verschiedenen Problemlagen in der Literatur bzw. der wissenschaftlichen Diskussion betrachtet werden. Dies ist erforderlich, um einen breiten Blick zu behalten, der nicht durch eigene Interessen und moraltheoretische Vorlieben beschränkt ist; es gibt keine Moraltheorie, die einen „Alleinherrschaftsanspruch“ erheben kann, und es interessiert die Praktiker*innen auch nicht, wie eine spezifische z.B. utilitaristische Autorin oder ein spezifischer kantianischer Autor die Sachlage einschätzt. Daher sind hier statt philosophische Methoden eher systematische Literaturrecherche und -Auswertungsmethoden gefragt, wie sie z.B. in der Medizin seit längerem bei systematischen Übersichtsarbeiten (systematic reviews) etabliert sind und die seit einigen Jahren auch in der interdisziplinären Medizinethik eine zunehmende Verbreitung erfahren (vgl. Mertz et al 2016). Das Ziel hierbei ist, ein möglichst vollständiges Spektrum der ethischen Aspekte, Argumente oder Positionen etc. zu einem Thema aus der bestehenden Forschungsliteratur zu extrahieren, ohne durch starke theoretische Vorentscheidungen die ethische Diskussion systematisch zu verzerren. Auf der Grundlage einer solchen breiten Literaturübersicht kann dann eine Leitlinie mit Inhalt gefüllt werden; hierfür ist ein gewisses philosophisches Methodenrepertoire zwar hilfreich (v.a. bei Ergebnissen, die nicht miteinander vereinbar sind), aber nicht zwingend erforderlich.
Schließlich benötigt man für C), die Sicherstellung der „Anwendbarkeit“ der Leitlinie, wiederum ein gewisses Maß an empirischer Einsicht über den Alltag in der Praxis. Man muss aber v.a. testen, ob die Formulierungen in der Leitlinie „ankommen“, ob die Praktiker*innen sie verstehen und ob auch die für sie wichtigen ethischen Herausforderungen etc. angesprochen wurden. Idealerweise prüft man z.B. mittels formaler Konsensverfahren, ob ausgewählte Vertreter*innen der Praxis den Leitlinieninhalten zustimmen können. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Leitlinie in der Praxis nicht verwendet wird. Wichtig ist hierfür u.a., die Stationen auf einer Klinik, in der die Leitlinie (pilot-)implementiert werden soll, frühzeitig bei der Entwicklung der Leitlinie „mit ins Boot“ zu holen – Leitlinien werden am besten gemeinsam mit Praktiker*innen entwickelt, getestet und implementiert (transdiziplinäre Methodik, vgl. Mertz 2011). Auch hierbei orientiert man sich nicht so sehr an philosophischen Methoden, sondern an Methoden, die u.a. in der Entwicklung medizinischer Leitlinien (zu Therapieoptionen, Risiken- und Nutzenpotentialen, Evidenzlage usw.) etabliert und erprobt sind.
Um nun abschließend die Frage im Titel des Beitrags aufzugreifen: ‚Macht‘ man noch Ethik, wenn man mit solchen Methoden zu solchen Zielen arbeitet? Ja und nein. Man ist sicherlich nur noch am Rande philosophischer Ethik unterwegs, was sich auch dadurch zeigt, dass die oben genannten Methoden keine (tiefere) philosophische Expertise abverlangen und daher solche Forschung auch von Mediziner*innen oder Sozialwissenschaftler*innen durchgeführt werden kann. Für die Praxis indessen dürfte diese Art der Tätigkeit viel mehr mit „Ethik“ zu tun haben als die meist abstrakteren Themen, mit denen sich philosophische Ethik beschäftigt. Es hat also auch mit dem Selbstverständnis der Disziplin bzw. „Inter-Disziplin“ zu tun, ob man solche Tätigkeiten noch der Ethik als zugehörig betrachtet oder gerade nicht mehr.
Mein damaliges konsternierendes Gefühl hat sich in den nachfolgenden Jahren, die vornehmlich durch Tätigkeiten in der interdisziplinären Medizinethik geprägt waren, jedenfalls nach und nach verflüchtigt.
Dr. phil. Marcel Mertz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte, Ethik und Philosophie der Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er ist dort Leiter der AG Forschungs-/Public Health Ethik und Methodologie.
Literatur
Ives J, Dunn M, Molewijk B, Schildmann J, et al. (2018) Standards of practice in empirical bioethics research: towards a consensus. BMC Medical Ethics 19:68
Mertz M, Kahrass H, Strech D (2016) Current state of ethics literature synthesis: a systematic review of reviews. BMC Medicine 14:152
Mertz M (2011) „Transdisziplinäre Forschung in der Klinischen Ethik. Chancen und Herausforderungen aus wissenschaftsforschender Perspektive – ein Fallbeispiel.“ In: Hügli A, Chiesa C, Dorthe G (Hrsg) Studia philosophica: An den Grenzen menschlichen Lebens. Gesundheit, Recht, Macht. Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft, Vol. 70/2011. Schwabe Verlag, Basel; S. 187-216