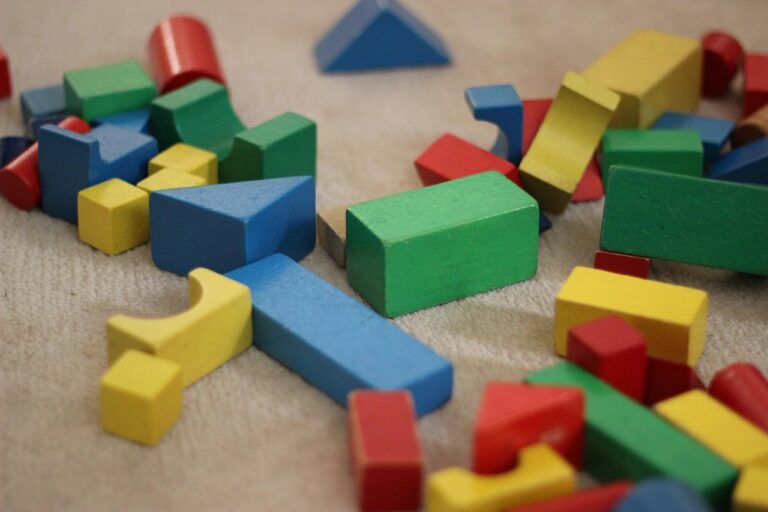Genug Bullshit! Über den Wert philosophischer Demokratiekritik in einer postfaktischen Welt
Andreas Wolkenstein (München)
Was Politiker vermeintlich tun – Stimmen der Straße
Als Angela Merkel am 03. Oktober 2016 die Dresdner Frauenkirche betrat, wurde sie von einem pöbelnden Mob empfangen. Die Menschen, die sich vor dem Ort der Feierlichkeiten zum Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung versammelten, waren offenbar wütend. Sehr wütend sogar, was sie mit wüsten Beschimpfungen und hetzerischen Plakaten zum Ausdruck brachten. Angela Merkel steht zwar im Zentrum der Kritik – wenn das Verhalten dieser angeblich besorgten Bürger denn überhaupt als Kritik zu bezeichnen ist -, doch diese trifft bei Weitem nicht nur die Bundeskanzlerin. Es herrscht dieser Tage die Tendenz, allen Politikern jeglichen guten Willen abzusprechen. Insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Regierungsparteien, dann aber auch die im linken politischen Spektrum zu verortenden Parteien werden zum Objekt des Hasses der Massen. Sie würden nur in die eigene Tasche arbeiten, es ginge ihnen also nur um sich, nicht um die Sorgen und Nöte der einfachen Leute, und sie würden mit „Gender Mainstreaming“ und „linksgrün-versiffter Ideologie“ die besorgte Bürger terrorisieren und diese dabei noch nicht einmal vor dem islamistischen Terrorismus beschützen (im Gegenteil). Derartige Dinge sind inzwischen nahezu alltäglich zu vernehmen. In Deutschland sitzen die Unterstützer dieser Form des Politiktreibens inzwischen im Parlament.
Was Politiker wirklich tun – die Stimme der Wissenschaft
Szenenwechsel: Empirische Studien sowie theoretische Analysen zeigen, dass zentralisierte Macht, wie sie in einem parlamentarischen System wie dem der Bundesrepublik gegeben ist, zu unschönen Effekten führt. Ein ganzes Forschungsfeld, das der “Public Choice“-Theorie, widmet sich der Untersuchung derartiger Phänomene. Am Beispiel des Fahrdienstbetreibers Uber und seiner Kritiker, den traditionellen Taxibetreibern weltweit, lässt sich beispielsweise aufzeigen, dass die gut vernetzte und lautstarke Lobby der Taxibetreiber oftmals erfolgreich gegen den Konkurrenten Uber agierte. Doch die Taxifahrer können nur erfolgreich sein, weil und wenn sie einen direkten Ansprechpartner hatten, der die Macht besitzt, Uber vom Markt fern zu halten: den Gesetzgeber. Wem Uber wegen der bestehenden Sexismus-Vorwürfe nicht gefällt, betrachte das Beispiel des Alkoholverbots in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Adam Smith und Bruce Yandle zeigten, dass sich hier zwei Kräfte unterschiedlicher moralischer Qualität zusammentaten, um ein Verbot von Alkohol zu erwirken, was weitaus schädlicher war, gemessen an der Zahl der Alkoholopfer, als andere Mittel um Alkoholmissbrauch zu verhindern. Auf der einen Seite waren Schmuggler und Schwarzhändler interessiert an dem Verbot. Sie standen dabei den “Gutmenschen” gegenüber, die aus moralischen Gründen den Alkohol ablehnten. Was beide zusammen zustande brachten, war ein Verbot von Alkohol – das aber nur durchgesetzt werden konnte, weil die “bootlegger” (die Schmuggler) und die “baptists” (die Gutmenschen) im Staat einen effektiven Durchsetzer des Verbots fanden. Adam Thierer und Brent Skorup listen eine Vielzahl ähnlicher Fälle im Bereich der Technologiepolitik auf, die allesamt darin ihren gemeinsamen Nenner finden, dass schädliche Regulierung nur zustande kommt, weil es eine Instanz gibt, die die Macht besitzt, Regulierung durchzusetzen. Eamonn Butler legt in seiner Einführung in die “Public Choice”-Theorie dar, warum das so ist: Politiker, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, wollen wiedergewählt werden. Um dies zu erreichen, vermitteln („to broker“) sie zwischen den verschiedenen Interessen. Dabei sind die Stimmen gut vernetzter und großer gesellschaftlicher Gruppen als „brokerage fee“ besonders wichtig. Politiker sind dabei nicht zwangsläufig böswillig, sondern agieren einfach nur in ihrem eigenen Interesse. Menschen werden eben nicht zu interesselosen Engeln, sobald sie Macht erhalten und Politiker werden.
Das innere Band zwischen Demokratiekritik und Politikpöbelei
Wer sich als politischer Philosoph, als politische Philosophin mit solchen Studien befasst, mag zu der Einsicht gelangen, dass an der parlamentarischen Demokratie so einiges zu kritisieren ist. Dass vielleicht in Wirklichkeit gar nicht das “demos”, das Volk, herrscht, sondern die Interessen der Politiker. Oder gar, dass die Herrschaft des Volkes gar nicht die beste aller möglichen Lösungen für die Organisation des Zusammenlebens ist. Vielleicht ist auch einfach das Mittel, mit dem Demokratien ihre Politiker auswählen, nicht zielführend. Wir bräuchten möglicherweise gar kein allgemeines Wahlrecht, sondern müssten nur die, die sich mit politisch-ökonomischen Zusammenhängen auskennen, wählen lassen.
Zudem: Wenn Politiker allem Anschein nach – und vor allem rationalerweise – ihre Handlungen danach ausrichten, was der Wiederwahl zuträglich ist, dann scheint doch der Schritt nahe zu liegen, dies nicht nur zu kritisieren, sondern Politiker selbst zu verdammen: Ja haben die denn gar keinen Anstand mehr? Und ist es dann nicht konsequent, diese Überzeugung auch auf die Straße zu tragen, oder zumindest ins Parlament? Der AfD-Politiker Marc Jongen ist offenbar zu einem solchen Schluss gelangt. Der ehemalige Assistent von Peter Sloterdijk an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe sitzt inzwischen für seine Partei im deutschen Bundestag.
Es scheint, als gäbe es ein inneres Band, das Demokratiekritiker und Politikpöbler miteinander verbindet. Ein Blick in die deutschsprachige libertäre Szene, die den Ideen der „Public Choice“ durchaus nahesteht, bestätigt diese Hypothese: Dort feiern Verschwörungstheorien, Rassismus, neurechtes und altrechtes Denken und vieles anderes „Anti-Establishment“-Agieren fröhlich Urständ. Beide Formen der Kritik nehmen ihren Ursprung in durchaus problematischen Resultaten demokratisch-parlamentarischen Entscheidens. Hat dies nicht zur Folge, dass man als Demokratiekritiker dieses Band auch akzeptieren muss? Andererseits: Man kann die Sprache und die Art, wie Kritik vorgetragen wird, ablehnen. Man muss ja auch nicht sämtliche anderen Meinungen und Positionen, die bei besorgten Bürgern im Kopf herumwabern, akzeptieren. Schließlich verbindet sich bei diesen ja nicht nur Sorge um die Effizienz des politischen Systems, sondern von Asylbewerberschelte bis hin zu handfester Xenophobie das ganze Spektrum rechter Ideologie. Aber grundsätzlich sollte der Demokratiekritiker doch zufrieden sein können mit dem, was auf Deutschlands Straßen (und neuerdings im Bundestag) passiert. Vielleicht muss man sich dann doch die Hände schmutzig machen, um das Richtige zu erreichen. Oder?
Politische Philosophie zwischen Prä- und Postfaktizität
Nichts wäre weiter von der Wahrheit entfernt. Denn es gibt gewaltige Unterschiede zwischen dem Philosoph, der Philosophin, die Kritik an der Demokratie übt, und dem besorgten Bürger. Und das betrifft bei Weitem nicht nur die Art, Kritik vorzubringen. Die Differenz ist tiefer zu verorten. Zum einen ist hier die konstruktive Zielrichtung philosophischer Kritik zu nennen. Philosophinnen und Philosophen wollen nicht einfach nur draufhauen, sondern verbinden üblicherweise ihre Kritik mit einer Lösung, die in den meisten Fällen den Anspruch hat, die Ideale der Demokratie besser zur Geltung kommen zu lassen. Ein Ansatz dazu findet sich in der Panarchie (die freilich schon älter ist als die meisten Ergebnisse der Public Choice). Im panarchistischen Ansatz wird versucht, den Individuen mehr Kontrolle über die Politik zu geben, indem das Wechseln der politischen Autoritäten erleichtert wird. So muss man hier nicht den Ort wechseln, um in eine andere Jurisdiktion, einen anderen Staat zu kommen, sondern kann sich ganz einfach in einer Art Behörde austragen und sich einer anderen, nicht-territorialen Autorität anschließen. Der Staat kommt zum Bürger, und nicht umgekehrt.
Philosophische Kritiker richten ihre Kritik auch nicht an Politiker im Einzelnen, sondern an das System Politik an sich. Dies wird unter anderem daran deutlich, dass das Verhalten der Politiker nicht einfach als böswillig betrachtet wird, sondern als rational und damit an sich durchaus lobenswert. Es ist nicht die Verfolgung rationaler Interessen, die kritisiert wird, sondern die Tatsache, dass Rationalität und das Gute in einem problematischen Verhältnis stehen. Einfach also Politik(er) zu verdammen und zu fordern, sie sollen mehr an das öffentliche Interesse, an das “public good” denken, hilft nicht. Und es ist letzten Endes auch moralisch fragwürdig: Kann man denn ernsthaft von anderen fordern, ständig gegen das eigene Interesse zu verstoßen? Sollte Moral nicht vielmehr dabei helfen, ein gutes Leben zu ermöglichen?
Darüber hinaus ergibt sich ein gewichtiger Unterschied im Verhältnis zu und im Umgang mit Fakten. Beide Kritiker, die philosophischen wie die von der Straße, arbeiten ja gewissermaßen postfaktisch. Doch nur die philosophische Variante ist berechtigt, denn allein sie zieht Fakten in ihre Überlegungen überhaupt mit ein. Philosophen orientieren sich ja nicht zuletzt an den Fakten der empirischen Forschung, ihre Arbeit beginnt also nach den Fakten. Diese Orientierung ist wichtig, um bei allem Nachdenken über Nicht-Empirisches nicht zu vergessen, dass es letztlich die reale Welt ist, über die Philosophen nachdenken wollen und in die sie hineinsprechen. Das Postfaktische der Straßenpöbler hingegen orientiert sich weder an Fakten noch an Nicht-Fakten. Ihnen scheint es einfach egal zu sein, was denn nun Fakt ist. Sie sitzen offenbar sehr tief im Bullshit, um mit Harry Frankfurt zu sprechen. Gefühlte Wahrheiten sind wichtiger und werden in ebenso gefühlsbetonte Ausdrucksformen gegossen. Postfaktisch ist also nicht gleich postfaktisch.
Mehr noch: die philosophische Postfaktizität verbindet sich üblicherweise mit einem präfaktischen Ansatz. Denn es ist ja nicht so, dass Philosophinnen und Philosophen empirische Erkenntnisse einfach zur Kenntnis nehmen, mit den Schultern zucken und sagen: “Dann müssen wir es halt anders machen”. Sie stützen sich nicht zuletzt auf präfaktische Überlegungen, Analysen und Einsichten, die zumeist in normativen Grundannahmen resultieren. So wird ja nicht der unantastbare Wert des Individuums negiert, und auch die Notwendigkeit einer politischen Ordnung wird nicht zwangsläufig abgelehnt.
Ideale Theorie in einer nicht-idealen Welt
Was folgt aus all diesen Überlegungen? Zum einen sollte deutlich werden, dass sich philosophisch überlegte Demokratiekritik keineswegs die Hände schmutzig und sich mit dem Anliegen besorgter Bürger eins gehen sollte. Dies gilt im Übrigen auch dann – oder besonders dann -, wenn man zwar die grundsätzliche Richtung bejaht, aber im Detail in Bezug auf die Sorgen der Straße differiert. Denn weder die Form der Kritik noch die philosophischen Implikationen sind unterstützenswert. Klares Denken kann also niemals die Pöbler der Straße verteidigen.
Zum anderen aber lässt sich an diesem Beispiel das Ziel des politischen Philosophierens schön aufzeigen. In der philosophischen Debatte wird aktuell viel darüber diskutiert, ob die Philosophie nun ideale Theorie machen sollte, oder doch eher nicht-ideale Theorie. Der Unterschied zwischen diesen Formen des Nachdenkens besteht in den Annahmen über die Menschen und ihre Handlungen bzw. das Objekt der Theorie. Ideale Theorie nimmt an, dass Menschen sich auch an die Vorschriften dieser Theorie halten. Wären alle Menschen vernünftig und gebildet (oder auch nur interessiert), lässt sich sicher eine schöne Demokratietheorie zimmern. Es sind nur nicht alle Menschen vernünftig, gebildet oder interessiert. Nicht-ideale Theorie hingegen weiß, wie nicht-ideal Menschen sind und baut dies in das Theoretisieren ein. Doch diesem Ansatz fehlen die Visionen und die Schönheit von begründeten Einsichten in Normen und Werte des Zusammenlebens. Wie sollten wir uns also entscheiden? Der Blick auf die Straßenphilosophie von Pegida und Konsorten auf der einen Seite und auf die philosophische Demokratiekritik auf der anderen Seite weist uns einen Weg: Wichtig ist für politische Philosophen nicht die Entscheidung zwischen idealer und nicht-idealer Theorie. Wichtig ist vielmehr das Nachdenken über die Vermittlung idealer Theorie in einer nicht-idealen Welt. Nur so wird verständlich, wie zwischen dem Anliegen der Philosophiekritik und der Politikpöbelei unterschieden werden kann. So wird auch verhindert, dass die guten Ideen der Philosophie in den üblen Schmähungen der Straße untergehen. Und schließlich wird so auch verhindert, dass sich das philosophische kritische Denken in unlauterer Weise mit einem politischen Aktivismus verbindet und in Gefahr gerät, nur noch Bullshit zu produzieren.
Damit verbinden sich nicht zuletzt einige Forderungen an die Philosophinnen und Philosophen, die über Demokratie nachdenken – und gerade auch an solche, die Demokratie durchaus kritisch sehen. Wenn man den hier vertretenen Überlegungen folgt, gilt es, die prä- wie die postfaktischen Elemente des eigenen Theoretisierens transparent zu machen. Wer also Kritik an der repräsentativen Demokratie übt, ist aufgefordert deutlich zu machen, was genau an dieser Regierungsform erhaltenswert scheint, warum man etwa den Wert der Person hochhält und inwiefern der oder die Einzelne in die Kontrolle der Politik einbezogen werden muss. Philosophinnen und Philosophen sollten darüber hinaus einen Kontrapunkt setzen zu dem faktenfreien Gebrabbel der Straßendemokratiekritik, indem sie nicht nur die eigenen Standpunkte deutlich machen, sondern auch verteidigen. Und indem sie in engem Austausch mit der Empirie stehen, gegebenenfalls auch, indem sie selbst empirische Forschung betreiben. So wäre es durchaus interessant und relevant zu wissen, ob ein panarchistisches System auch funktioniert, und auf welche Weise.
All diese Forderungen kulminieren in der grundsätzlichen Aufforderung, dass Philosophinnen und Philosophen die Relevanz des eigenen Tuns deutlicher machen müssen als sie dies bisher tun. Jetzt ist die Zeit in der sich der Wert des Philosophierens für die Welt zeigen kann. Es gilt daher, weniger darüber nachzudenken, ob jetzt ideale oder nicht-ideale Theorie das Ziel des eigenen Tuns ist. Das kann man sich getrost für spezialisierte Konferenzen vormerken. Vielmehr sollten die Bemühungen darauf verlegt werden, ideale Theorie in und vor allem für eine nicht-ideale Welt zu machen.
Andreas Wolkenstein arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit neuroethischen Themen und der Ethik künstlicher Intelligenz. Sein besonderes Interesse gilt der politischen Philosophie und dem Versuch, verschiedene angewandte Ethiken unter dem Blickwinkel der politischen Philosophie zu betrachten. Er hat in Tübingen und Paris Philosophie, Theologie und Geschichte studiert.