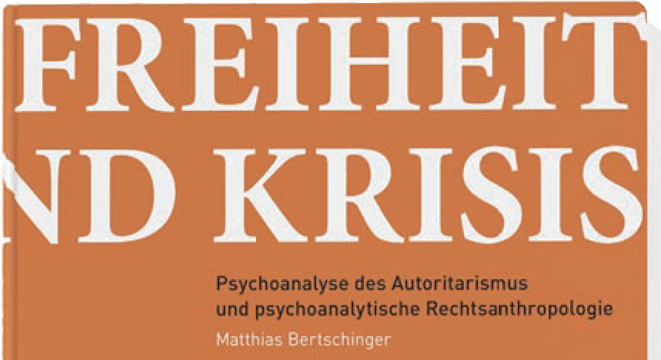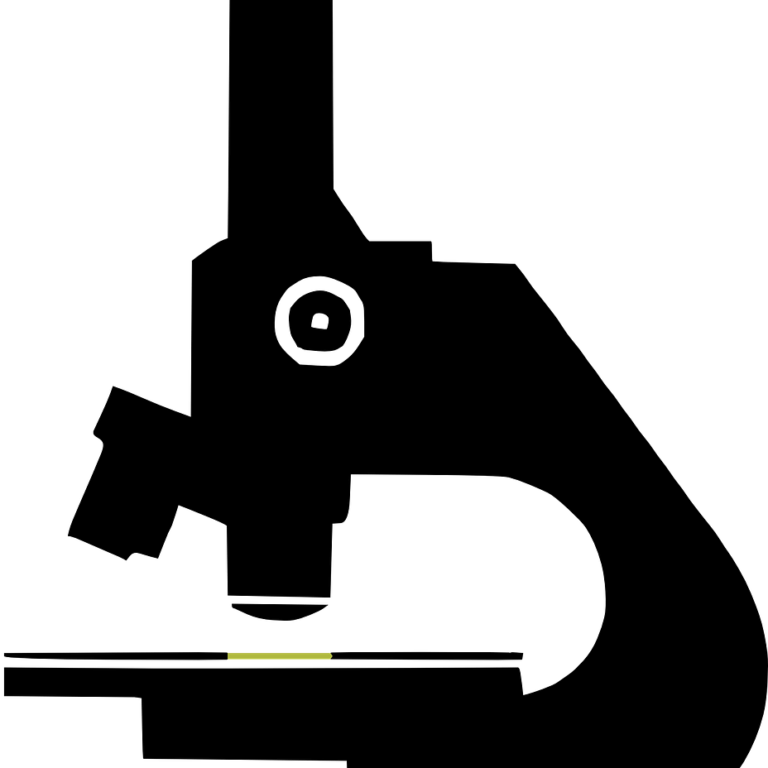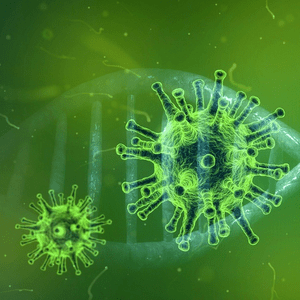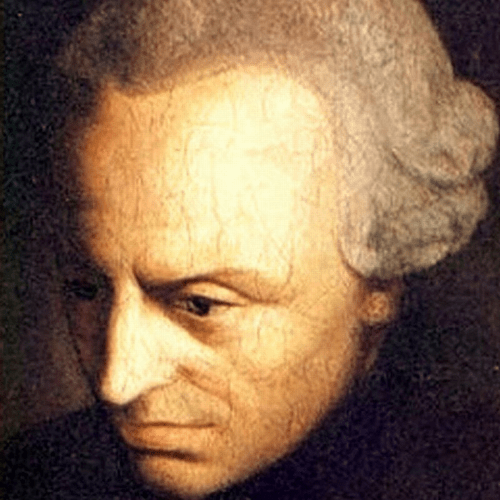Zwischen Tugend- und Sozialethik: Armut in der Patristik und im Frühmittelalter

Dieser Blogbeitrag bezieht sich auf einen ausführlichen Beitrag im neuen Handbuch Philosophie und Armut, welches im April 2021 bei J.B. Metzler erschienen ist. Von Peter Schallenberg (Mönchengladbach) Alles Nachdenken einer christlich inspirierten Philosophie zur Armut beginnt mit dem programmatischen Satz Jesu: „Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz!“…