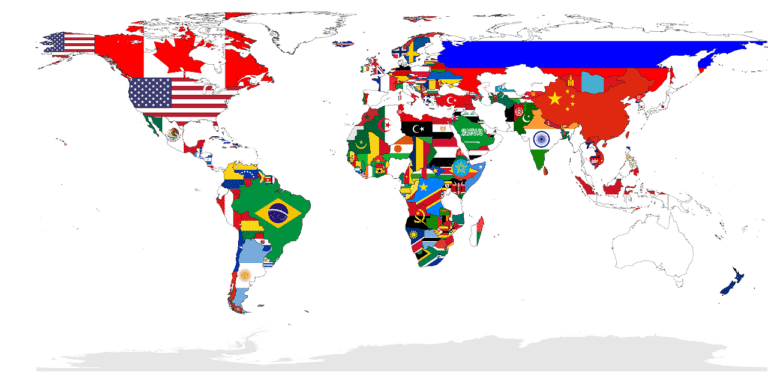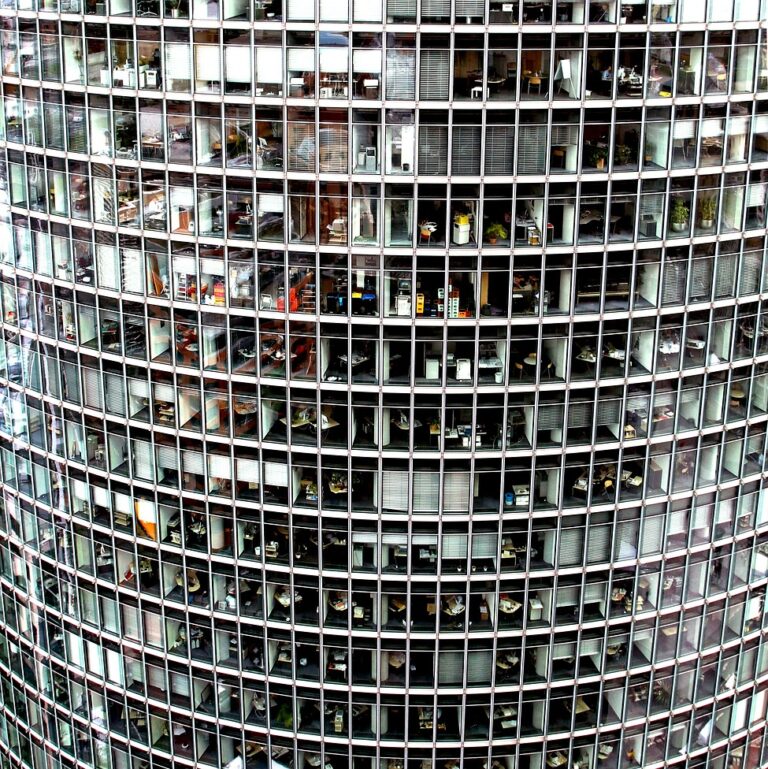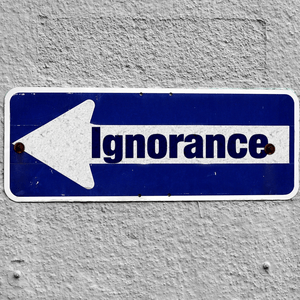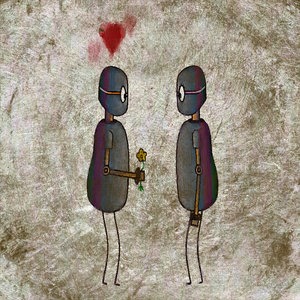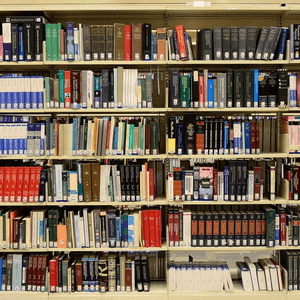Uninformed Non-Consent: Widerspricht eine Impfpflicht dem Autonomieprinzip?
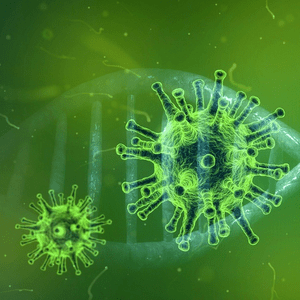
von Daniel Lucas (Marburg) In Deutschland wird aktuell wieder über eine Impfpflicht – in medizinischen Berufen im Besonderen, aber auch im Allgemeinen – diskutiert. Grund dafür ist die niedrige Impfquote und die damit einhergehende Gewalt, mit welcher die vierte Corona-Welle auf die Bundesrepublik trifft. Während insbesondere der Schutz Dritter als…