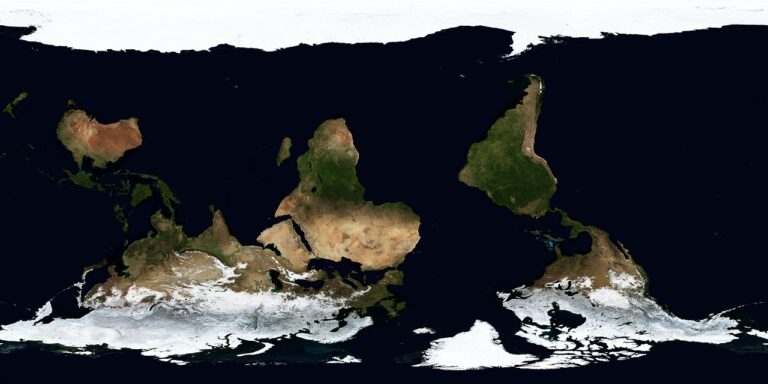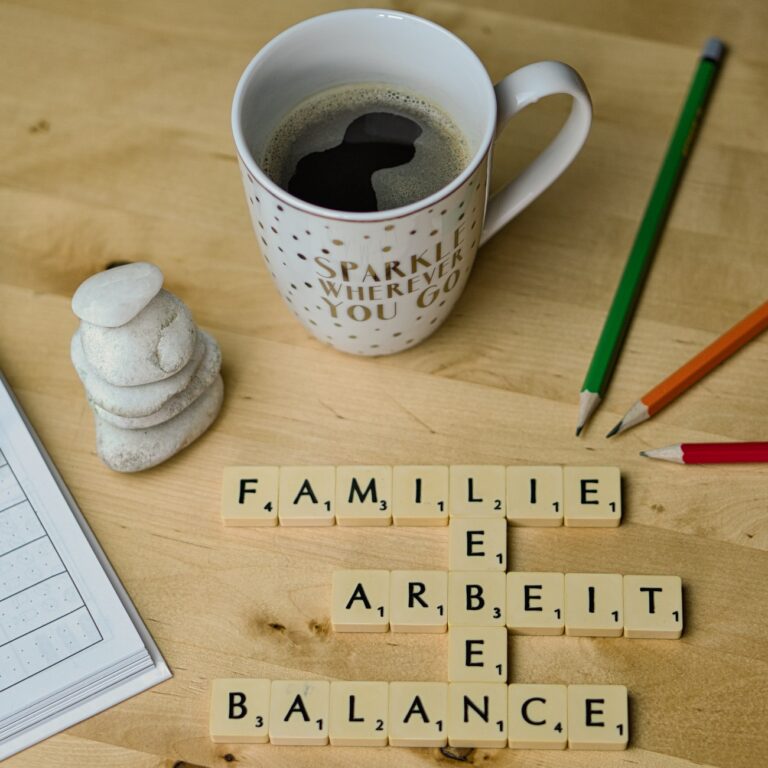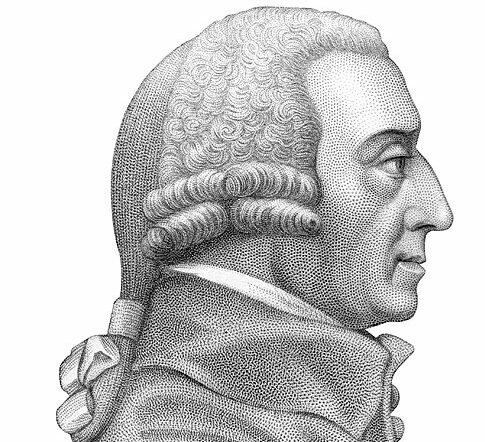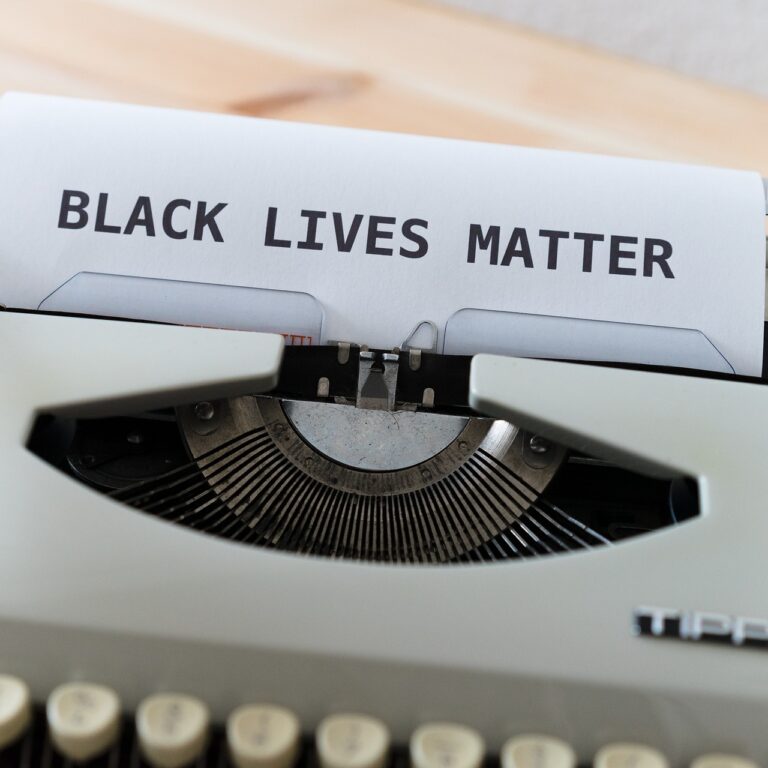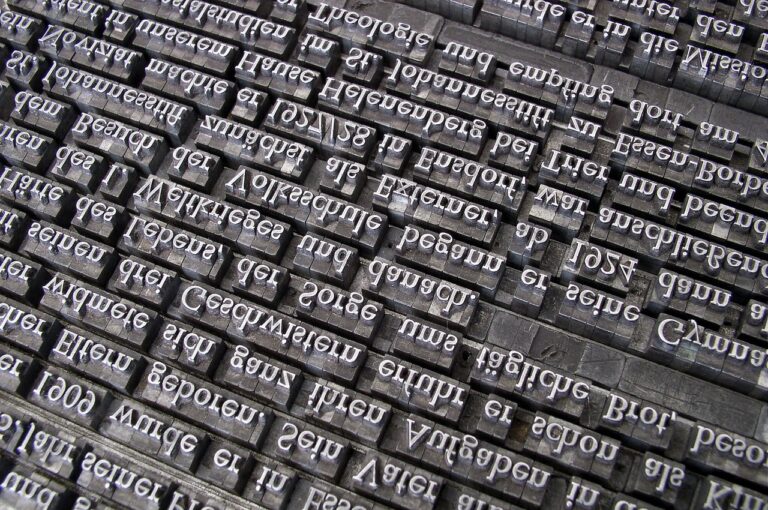Splitter zur Philosophie des Flirtens

Von Gottfried Schweiger (Salzburg) [1] Liebe ist ein klassisches Thema der Philosophie. Der Prozess des Verliebens schon weniger und wenn es ums Flirten geht, hat die Philosophie – bislang – fast nichts zu sagen. Dabei ist Flirten nicht nur eine häufig anzutreffende und bei vielen Menschen beliebte Interaktion, sie wirft…