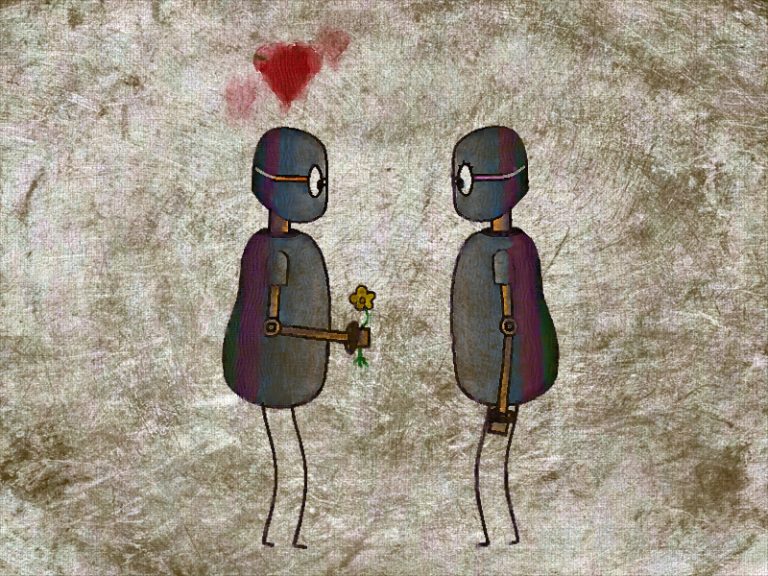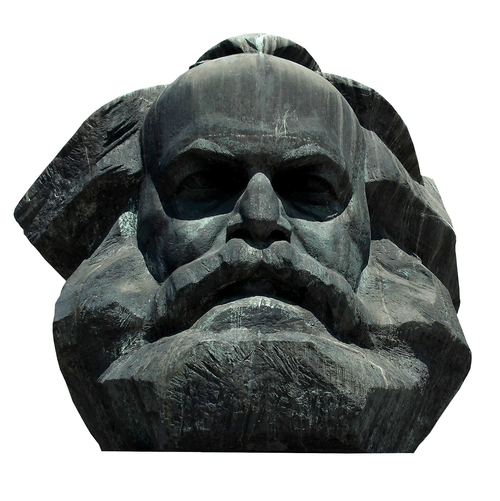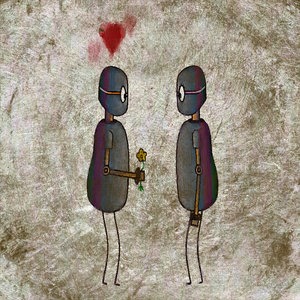Was genau machen eigentlich PhilosophiehistorikerInnen?
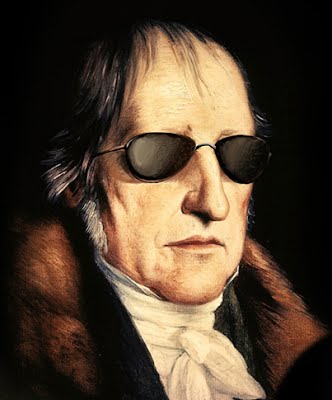
von Sebastian Bender (Berlin) „Und was machst du so?“ ist eine Frage, die sich Philosophinnen und Philosophen häufig gegenseitig stellen, sei es am Rande von Tagungen oder auf Partys mit hinreichend vielen PhilosophInnen. Gefragt wird dabei nach dem Spezialgebiet (der Area of Specialization, kurz: AOS) zu dem jemand forscht, also…