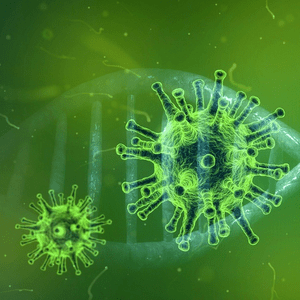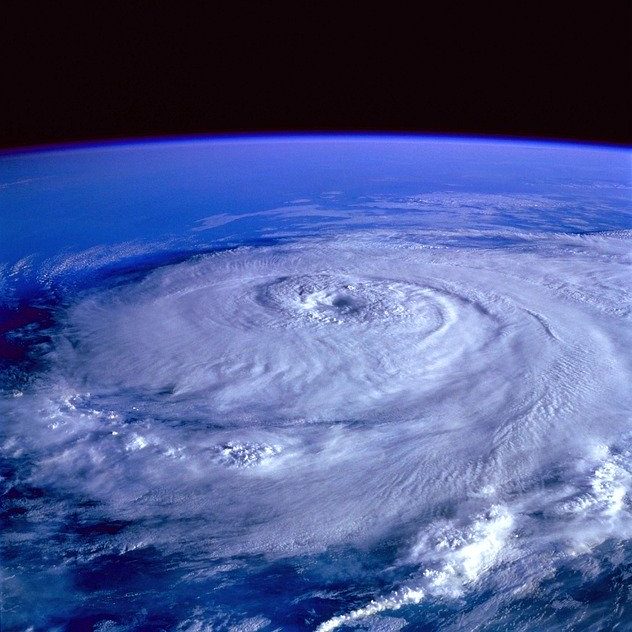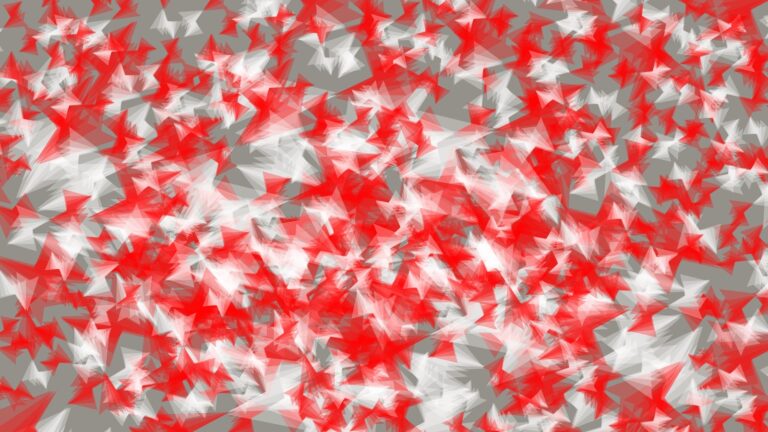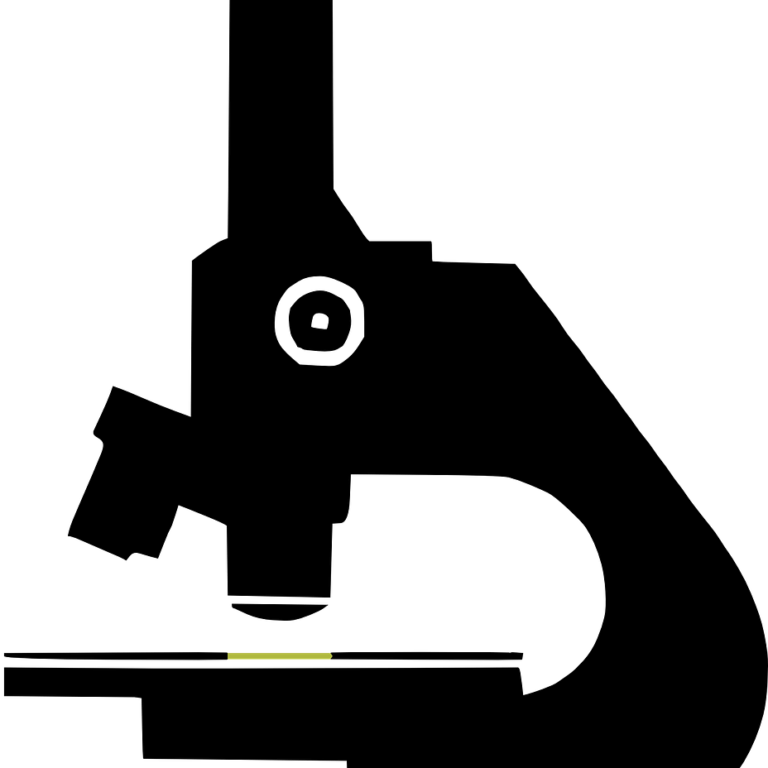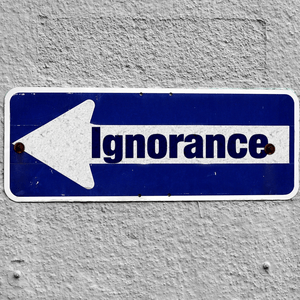Hegels Nützlichkeit

Von Jonas Heller (Frankfurt am Main) In seiner Phänomenologie des Geistes hat Hegel eine Dialektik der Aufklärung formuliert, die für die kritische Theorie der ersten Generation schulbildend wurde. Die dialektische Diagnose lautet: Im Prozess ihrer Verwirklichung zerstört sich die Aufklärung selbst.[1] Die Verwirklichung der Aufklärung erfolgt als Prozess der Befreiung.…